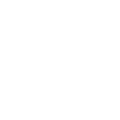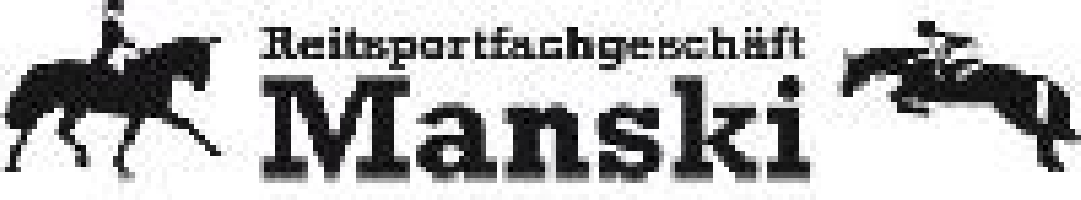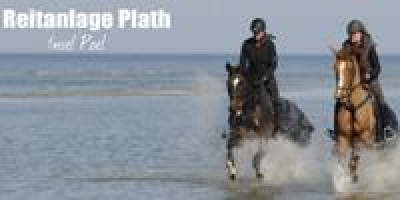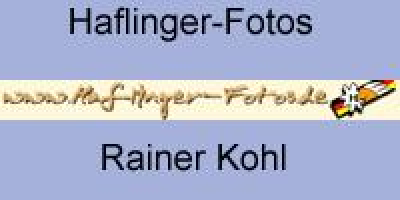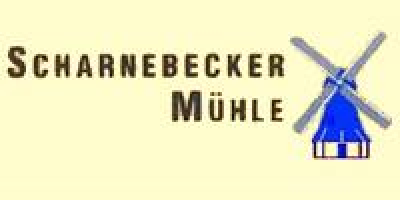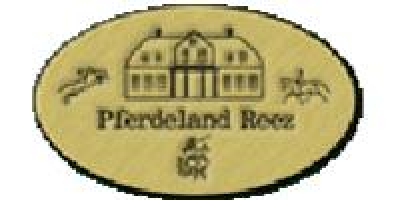Anlage und Nutzung von Pferdeweiden (Teil 1)
Erschienen am 30.03.2012
Der Rat eines Wissenschaftlers und Experten
Von Wilhelm Simon, Prof em.Dr.habil., Schwerin, der sich über die Stationen Bad Doberan (Lehrer an der Fachschule für Landwirtschaft), Müncheberg, Bernburg (Hochschul-Lehrstuhl) und als Abteilungsleiter am Institut für Grünlandforschung Paulinenaue sein ganzes Berufsleben mit Grünland befasst hat (1).

Nun sieht man die Düngerstreuer wieder an allen Orten. Doch düngen allein genügt nicht - auf das komplette Weidemanagement kommt es an. Foto: Wego
Einleitung:
Die Grundsätze der Weidebewirtschaftung sind in diesem Beitrag über Weiden für alle Weidetiere besonders detailliert dargestellt worden bzw. können hieraus abgeleitet werden, weil hierbei in praxi leider noch immer die meisten Fehler gemacht werden. Dies ist das kurz gefasste Ergebnis meiner etwa fünfzigjährigen praktischen und wissenschaftlichen Arbeit in der Graslandbewirtschaftung.
Die Bodenansprüche
Die Bodenansprüche an Weiden vornehmlich für Pferde sind größer als die bei anderen Haustierarten. Durchlässige, gut strukturierte Mineralbodenstandorte sind hierfür am besten geeignet. Auf schweren, ton- und kalkreichen Verwitterungsböden liegt ein geringes Infiltrationsvermögen und eine sehr hohe wasserspeichernde Kraft vor, so dass sie nach Starkregen sowie vom Spätherbst bis Frühjahr wegen Übernässung häufig nicht betretbar sind und, vor allem bei kleinhufigen Pferden, erhebliche Trittschäden an der Weidenarbe auftreten können. Für solche Perioden muss dann im Stall bzw. an einem befestigten Futterplatz ausreichend Konservatfutter verfügbar sein. Auch tiefgründige Niedermoore sind in Feuchteperioden nicht ausreichend trittfest und erlauben keine kontinuierliche Beweidung durch Pferde, auch keine durchgängige Winterweide.
Bodenvorbereitung für die Neuansaat
Außer auf reinen Sandböden und stark hängigen Flächen ist möglichst tiefe Spätherbstfurche richtig, das Land bleibt in rauher Furche über Winter liegen. Nur dadurch kann das Ziel "Frostgare" auf allen lehmigen Böden erreicht werden. Nach dem Abtrocknen und Erreichen der Befahrbarkeit wird das Land schräg zur Furche geschleppt; danach kann meistens ohne jegliche Nacharbeit die Neuansaat erfolgen. Nur dann, wenn zu befürchten ist, dass sich wegen Vernässung die Saat stark verzögert, sollte bei erster Befahrbarkeit durch mitteltiefen Grubbereinsatz (< 15 cm tief) die Abtrocknung beschleunigt werden. Durch frühestmögliches Schleppen danach (auch mit auf dem Rücken liegenden leichten Eggen) wird das für Feinsämereien erforderliche nur 2-3 cm flache, feinkrümelige Saatbett erreicht.
Tiefe Bodenlockerung im Frühjahr führt zumeist zu feuchte-zehrender und grobklutiger Oberfläche, die trotz wiederholter mechanischer Arbeitsgänge kein feines Saatbett für die Feinsämereien ermöglicht und wegen unterschiedlicher Tieflage der Samen einen ungleichmäßigen Aufgang, damit auch eine unerwünschte Komponentenverschiebung, zur Folge hat.
Auf Sandböden ist eine wintergrüne bzw. abgestorbene Bodenbedeckung wegen verminderter Auswaschungsgefahr zu bevorzugen; mehr noch gilt dies auf stark hängigen Flächen, gleich welcher Bodenart, zur Verringerung der Oberflächenerosion. Hier genügt im Frühjahr, so früh wie irgend möglich, eine sehr flache Pflugfurche (< 15 cm), evtl. kombiniert mit einer relativ flachen Unterbodenlockerung bis 4 cm unter Krumentiefe.
S a a t
Saatmethode: Empfohlen wird, die Saatgutpartner einzeln zu bestellen und vor der Aussaat selbst gut zu mischen. Sofern erstmalig auf dem Standort auch Leguminosen (Weideluzerne, Weiß- und Gelbklee) der Saatmischung beigemengt werden, sind zuvor die Leguminosen mit Rhizobienkulturen zu impfen (meist mit großem Erfolg) und diese dann unmittelbar vor der Aussaat der Gräsermischung beizufügen (Impfen nur unter Dach, niemals mit direkter Sonneneinwirkung!).
Nur Aussaat mit Drillmaschinen gewährleistet die notwendige flache (1-2 cm tief), gleichmäßig tiefe Saat. Nach der Drillsaat darf nicht geeggt werden, d.h. keine nachträgliche Oberflächenlockerung erfolgen. Jedes Drillschar wirkt wie eine Mini-Walze, die unmittelbar darunter einen etwas gefestigten feuchteren Horizont bewirkt, auf dem das Saatgut gleichmäßig quillt, keimt und aufgeht. Die Drillgeschwindigkeit darf dieses Effektes wegen nicht über 5 km/h betragen.
Zu lockere Bodenoberfläche nach der Saat kann evtl. mit Glatt- oder Ringelwalzen angedrückt werden. Sofern der Boden an den Walzen klebt, ist Abtrocknen der Oberfläche abzuwarten. Durch bald nach der Saat folgenden Regen erübrigen sich alle weiteren Arbeitsgänge. Und sollte die Bodenoberfläche durch Regen vor der Saat verschlammt und anschließend verkrustet sein, ist unmittelbar vorausgehendes leichtes Eggen bzw. mit dem Drillen kombiniertes flaches Aufrauhen angezeigt.
Bodenvorbereitung und Saat werden hier deshalb so detailliert dargestellt, weil Fehler sehr häufig und nur schwer korrigierbar sind. Unterschiedliche und zu große Saattiefen können zu völlig veränderter Bestandeszusammensetzung und schwachem Aufgang führen. So gehen bspw. Feinsämereien wie Wiesenrispe, Lieschgras (Timothe) und Rotschwingel bei Saattiefen von >3 cm überhaupt nicht mehr oder nur ganz vereinzelt und geschwächt auf.
Wenn der Saattermin drängt und das Land noch immer nicht befahrbar ist, dann ist Aussaat per Hand - nur auf rauhe Bodenoberfläche - angebracht. Dazu wird die jeweils halbe Saatmenge über kreuz (mit drei Fingern) gesät, auf jeden Schritt dosiert werfend. Nach dieser Breitsaat sollte etwa eine Woche abgewartet werden. Sofern in dieser Zeit Regen fällt, erübrigt sich das Anwalzen, das aber sonst erforderlich wird. Durch das Walzen werden zudem kleinere Steine eingedrückt, die sonst später beim Mähen (für's Konservatfutter) erheblich stören können. Wegen der geplanten langen Nutzungsdauer der Pferdeweiden sind alle größeren Steine unbedingt abzusammeln.
Saatzeit: Günstig - außer in Höhenlagen - sind bei uns die Dekaden II/3-II/4 sowie I-III/8. Alle übrigen Saatzeiten sind entweder wegen oft eintretender Fröste oder Trockenheit riskanter; nach III/9 besteht häufig Frühfrostgefahr.
Saatmischung: Ziel ist immer: Standortanpassung und lange Leistungs- und Lebensdauer, auch bei unvermeidlicher Weidetrittbelastung, guter Futteraufnahme und langer Jahresweidezeit.
Vorzugsmischung für nahezu alle Pferdeweiden in Deutschland):
6 kg/ha Knaulgras - früher Weidetyp (Dacthylis glomerata)
8 kg/ha Rohrschwingel-Weidetyp (Festucaarundinacea)
3 kg/ha Wiesenrispe - ausläufertreibend (Poa pratensis)
2 kg/ha Rotschwingel - ausläufertreibend (Festuca rubra)
4 kg/ha Gelbklee (Medieago lupulina) oder Weideluzerne (Medicago varia)
2 kg/ha Weißklee (Trifolium repens)
Summe: 25 kg/ha.
 Diese für Drillsaat ausreichende (sogar reichlich bemessene) Saatmenge ist bei Handsaat/Breitsaat um jeweils 15% zu erhöhen. Knaulgras und Rohrschwingel sind relativ hochwüchsige, frühtreibende Obergräser, die vor dem Rispenschieben der Hauptgräser gemäht ein sehr gutes Pferdeheu ergeben können, außerdem gut beweidbar sind, letzteres besonders als Spätherbst- und Winterweide. Wiesenrispe und Rotschwingel führen zu trittfester, tragfähiger Grasnarbe; sie schließen auftretende Lücken und erhöhen auch den Herbstweideertrag. Die o.g. Saatmischung kann auch für Rinderweiden, z.B. speziell für Mutterkuhhaltung verwendet werden, auch auf Niedermoorstandorten. Hier sollte jedoch Weißklee durch Hornklee ersetzt werden. Auf frischen Mineralböden und flachem Anmoor müssen bei Rinderweiden Rohrschwingel und Knaulgras besser durch etwa 12 kg/ha Ausdauerndes (Deutsches) Weidelgras oder Wiesenschweidel ergänzt werden. Rotschwingel wird hier (besonders auf Niedermoor) teilweise durch Lieschgras (2-3 kg/ha) ersetzt.
Diese für Drillsaat ausreichende (sogar reichlich bemessene) Saatmenge ist bei Handsaat/Breitsaat um jeweils 15% zu erhöhen. Knaulgras und Rohrschwingel sind relativ hochwüchsige, frühtreibende Obergräser, die vor dem Rispenschieben der Hauptgräser gemäht ein sehr gutes Pferdeheu ergeben können, außerdem gut beweidbar sind, letzteres besonders als Spätherbst- und Winterweide. Wiesenrispe und Rotschwingel führen zu trittfester, tragfähiger Grasnarbe; sie schließen auftretende Lücken und erhöhen auch den Herbstweideertrag. Die o.g. Saatmischung kann auch für Rinderweiden, z.B. speziell für Mutterkuhhaltung verwendet werden, auch auf Niedermoorstandorten. Hier sollte jedoch Weißklee durch Hornklee ersetzt werden. Auf frischen Mineralböden und flachem Anmoor müssen bei Rinderweiden Rohrschwingel und Knaulgras besser durch etwa 12 kg/ha Ausdauerndes (Deutsches) Weidelgras oder Wiesenschweidel ergänzt werden. Rotschwingel wird hier (besonders auf Niedermoor) teilweise durch Lieschgras (2-3 kg/ha) ersetzt.
Besonders im Öko-Landbau sind legume Beisaaten von Belang, weil sie einen Teil des benötigten disponiblen Stickstoffs (N) bereitstellen, ohne dass zusätzlich mit N gedüngt werden muss.
Sofern Saatgut von Immergrüner Trespe (Bromus catharticus) verfügbar ist, sollten davon ca. 15 kg/ha der o.g. Mischung zugegeben werden, um eine noch bessere Winterbeweidung und zugleich Langlebigkeit der Narbe zu erreichen. Für die Ansaat von Pferde- und Schafweiden auf Mineralböden ist diese Grasart besonders zu empfehlen; dieses großfrüchtige Saatgut ist vor der Drillsaat der Mischung (meist als Breitsaat) auszubringen.
Bei größerer Hangneigung der Ansaatflächen wird zusätzlich zur o.g. Mischung die Zumischung von 4 kg/ha Ausdauerndem =Deutschem Weidelgras (späte Weidetypen von Lolium perenne) empfohlen, zwecks schnellerer Narbenschließung nach der Ansaat, auch, um grundsätzlich einer stärkeren Bodenerosion bei Starkregen und in der Schneeschmelze entgegen zu wirken.
Nachsaaten werden - außer nach Beweidungsfehlern - vor allem am Tränk- oder Futterplatz und an den Eintriebsstellen erforderlich. Narbenschäden können auch durch zu tiefen, scharfen Verbiss, meist verursacht durch zu lange wahrenden Verbleib auf derselben Weidefläche infolge selektiver Futteraufnahme entstanden sein, so dass auch partielle, kleinflächige Nachsaaten sinnvoll werden können. Die Nachsaatmenge liegt meistens bei 40-60% der Vollsaatmenge. Nur nach relativ guter Saatbettvorbereitung können zur Nachsaat auch die kleinsamigen Arten mit ausgedrillt werden. Mit größerer Sicherheit gelingt die Nachsaat - besonders auf schwieriger vorbereiteten Kleinflächen - nur mit großfrüchtigen Arten wie Weidelgräser, Wiesenschweidel, Rohrschwingel, Immergrüne Trespe, auch Wiesenschwingel und Knaulgras. Nachsaaten in Grasnarben sind umso sicherer, je niedriger die Wuchshöhe des Bestandes ist, Relativ kahles Abweiden vor der Nachsaat ist deshalb angebracht, um damit frühzeitige Konkurrenz auszuschalten, zumindest zu reduzieren. Unkrautnester sind vor der Nachsaat mechanisch zu "rasieren".
Drillsaat oder Breitsaat setzen immer eine gewisse Einebnung der Fläche voraus und erfordern auch feuchtkrümeliges Saatbett; Aussaat in "Asche" ist sinnlos. Nachfolgend ist schweres Anwalzen, optimal mit Rauhwalzen, zweckmäßig, aber Nachsaaten niemals eineggen!
Breitsaaten (per Hand, d.h. bei kleinkörnigen Leguminosen mit drei Fingern breitwürfig gesät) werden am besten bei Regenwetter durchgeführt. Zur sukzessiven Qualitätsverbesserung der Weidenarben werden kontinuierliche Nachsaaten empfohlen, einmal pro Jahr, am besten um Mitte/Ende August, jeweils nach scharfer Mähnutzung (mulchen/schlegeln), mit anschließendem Rauhwalzen oder leichtem "netzeggen" - oder vor dem Weideauftrieb, etwa Ende August, die Nachsaat wird durch die Weidetiere eingetreten. Ökobetrieben wird diese regelmäßige Nachsaat mit etwa 200-300 g/ha an Weißklee oder Hornklee, auch/oder 600-800 g/ha (ausläufertreibende) Weideluzerne dringend empfohlen.