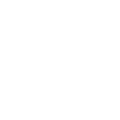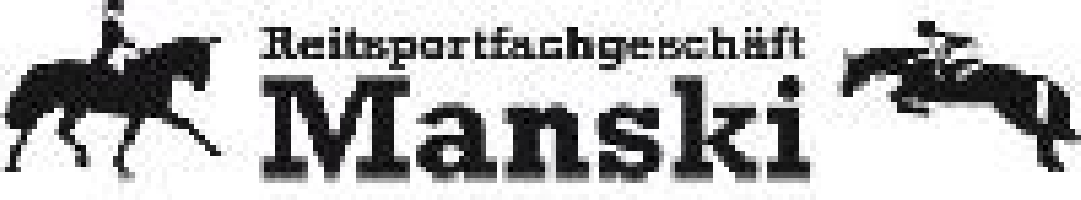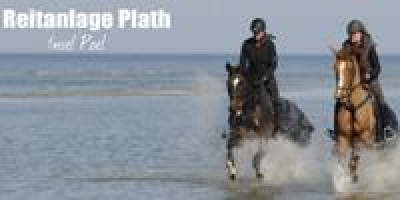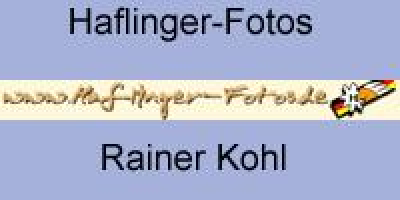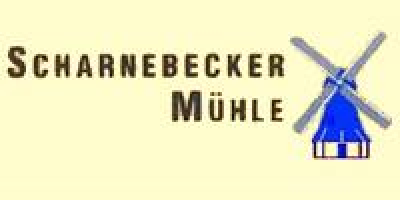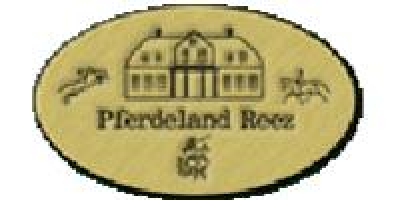Rechtsfälle aus der Praxis
Erschienen am 05.10.2011
Unf.jpg) all in der Führanlage
all in der Führanlage
Zum Service vieler Pferde-Pensionsställe gehört seit langer Zeit eine Führanlage. Dass die Nutzung nicht ganz ungefährlich ist, weiß eigentlich jeder Pferdehalter. Zwar sind schwerwiegende Verletzungen bei Pferden in der Führanlage eher selten, im Schadensfall aber wird regelmäßig der Stallinhaber zur Verantwortung gezogen.
Die Erfahrung, für die Folgen von in der Führanlage seines Pferde-Pensionsbetriebes erlittene Verletzungen eines eingestellten Pferdes haften zu sollen, machte der Beklagte eines beim Landgericht Saarbrücken geführten Rechtsstreites. Er bot gegen ein geringes Entgelt die Nutzung der Führanlage an, in der gleichzeitig vier Pferde auf einer Kreisbahn bewegt werden konnten. Die "Abteile" für die Pferde wurden getrennt durch ein aus Metalldraht gefertigtem Gitter mit einem Stahlrohrrahmen. Das Pferd der Klägerin hatte durch dieses Gitter geschlagen und sich dadurch schwer wiegende Verletzungen zugezogen. Sie verlangte vom Stallinhaber Ersatz der Tierarztkosten mit der Begründung, die Konstruktion der Führanlage sei nicht ordnungsgemäß gewesen. Das Gitter, in welchem sich ihr Pferd mit einer Hintergliedmaße verfangen hatte, habe schon vor dem Unfall Beschädigungen aufgewiesen. Sie selbst habe die Unsicherheit und Gefährlichkeit der Anlage nicht erkennen können, während der Stallinhaber grob fahrlässig den Schaden verursacht habe.
Dem hielt der Stallbetreiber entgegen, dass die Gitter der Führanlage üblichen Beanspruchungen durchaus Stand hielten. Es sei nie ein anderes Pferd zu Schaden gekommen. Die Stute der Klägerin sei zu wenig bewegt worden, habe zudem die notorische Unart gehabt auszuschlagen.
In dem Fall kam hinzu, dass nach Angaben des Beklagten der Klägerin untersagt worden war, die Führanlage zu nutzen wegen des auffälligen Verhaltens ihrer Stute.
Das Urteil des Landgerichts
Das Landgericht (LG) sah sich zunächst einmal veranlasst, den Sachverhalt aufzuklären. Es hatte allerdings kein Gutachten dazu eingeholt, ob nun die Führanlage technisch dem neuesten Stand entsprochen hatte. Vielmehr wurden Zeugen zu der Frage gehört, ob der Klägerin tatsächlich die Nutzung der Führanlage untersagt worden war. Das hatten die Zeugen bestätigt.
Insoweit liegt natürlich eine besondere Fallkonstellation vor. Allerdings sah das LG auch Veranlassung, sich mit grundsätzlichen Anforderungen auseinanderzusetzen. Es meinte:
"Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist derjenige, der eine Gefahrenlage - gleich welcher Art - schafft, grundsätzlich verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung Anderer möglichst zu verhindern. Die rechtlich gebotene Verkehrssicherung umfasst diejenigen Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtig denkender Mensch für notwendig und ausreichend hält, um Andere vor Schäden zu bewahren. Deshalb muss nicht für alle denkbaren Möglichkeiten eines Schadenseintritts Vorsorge getroffen werden. Es sind vielmehr nur die Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Schädigung anderer tunlichst abzuwenden."
Der zitierte Maßstab wäre dann letztlich entscheidend gewesen für die Frage, ob die Führanlage sich in einem einwandfreien Zustand befunden hat. Das LG meinte, dass generell eine Haftung des Beklagten als Betreiber der Führanlage in Betracht komme. Im konkreten Fall jedoch trete ein etwaiges Verschulden des Beklagten gegenüber einem ganz überwiegenden Eigenverschulden der Klägerin zurück.
Letztlich entscheidend war daher der Einwand des Beklagten, dass er der Klägerin die Nutzung der Führanlage untersagt hatte. Die Zeugen hatten ein solches Verbot bestätigt. Der Stallinhaber sah sich dazu veranlasst, weil die Stute der Klägerin zum Ausschlagen neigte, daher sowohl das Pferd als auch die Führanlage jeweils gefährdet waren.
Das Mitverschulden
Dass sich die Klägerin über das ausgesprochene Verbot hinweggesetzt hatte, wurde ihr als Mitverschulden angerechnet. Bei einem Schadensfall führt die Anrechnung eines Mitverschuldens des Geschädigten zu einer Schadensteilung, zu einem Wegfall der Schadensersatzpflicht oder zu einer vollen Haftung des Schädigers. Insoweit hat das Gericht jeweils eine Abwägung vorzunehmen. Ein Schadensersatzanspruch scheidet letztlich dann aus, wenn ein Verschulden des Schädigers gegenüber dem Mitverschulden des Geschädigten zurückzutreten würde ? so das LG. Genau das sei hier der Fall. Für die Klägerin habe das ausgesprochene Verbot Anlass sein müssen, auf die Nutzung der Führanlage gänzlich zu verzichten. Wenn sie dennoch ihr Pferd in der Führanlage bewegt habe, könne das nur dahin verstanden werden, dass das Risiko bewusst in Kauf genommen worden sei.
Das Berufungsverfahren
Die Klägerin des Rechtsstreites griff das Urteil des LG an. Das Saarländische Oberlandesgericht bestätigte, dass grundsätzlich der Betreiber einer Führanlage gegenüber berechtigten Benutzern für die Verkehrssicherheit der Anlage einzustehen habe. Es sei seine Verpflichtung, diejenigen Maßnahmen durchzuführen, die ein umsichtiger und verständiger, in den vernünftigen Grenzen vorsichtiger Betreiber einer solchen Anlage im Rahmen des Zumutbaren für notwendig und ausreichend halten müsse, um Pferdehalter vor Schäden zu bewahren. Allerdings sei anerkannt, dass absolute Sicherheit nicht gefordert werden könne.
Das OLG ging noch weiter als das Landgericht. Nach seiner Auffassung fehlte es bereits an dem Beweis, dass ein möglicherweise nicht verkehrssicherer Zustand der automatischen Führanlage für die Verletzung des eingestellten Pferdes ursächlich geworden sei. Wenn nämlich eines der Gitter einen Schaden aufgewiesen habe, so sei das allein nicht ausreichend, um eine Schadensersatzpflicht des Stallinhabers anzunehmen. Vielmehr müsse die Klägerin konkret darlegen, dass die Vorbeschädigung sich ausgewirkt habe. Das OLG schränkte die Verkehrssicherungspflicht des Stallinhabers dahingehend ein, dass selbst bei absolut ordnungsgemäßer Ausgestaltung der Führanlage Schadensfälle nicht generell vermieden werden könnten. Es gäbe keinen allgemeinen Erfahrungssatz, dass besonders temperamentvolle oder auch in Panik geratende Pferde unabhängig davon, wie häufig und heftig sie mit der Hinterhand ausschlagen, ein intaktes Gitter nicht so beschädigen könnten, dass sie sich darin verfangen und verletzen würden. Diese Auffassung erscheint durchaus lebensnah, zumal letztlich jedem Pferdehalter bekannt ist, dass es eine Pferdehaltung ohne Risiko nicht gibt. Selbst die Unterbringung in einer Boxe, die technisch einwandfrei eingerichtet ist, schließt ein Verletzungsrisiko beispielsweise durch Festliegen nicht aus.
Das OLG ließ allerdings auch die Argumentation des Landgerichts gelten. Es sei - so das OLG - allgemein anerkannt, dass der Stallinhaber berechtigt sei, "den Kreis der befugten Teilnehmer zu beschränken mit der Folge, dass er keine Sicherungsmaßnahmen zu Gunsten unbefugter Personen ergreifen müsse". Die Verkehrssicherungspflicht des Stallinhabers kommt daher letztlich nur denjenigen zu Gute, die berechtigterweise die Führanlage nutzen.
Mehr noch: die Klägerin hatte in der mündlichen Verhandlung letztlich eingeräumt, bereits vor dem Unfall erkannt zu haben, dass sich ein Pferd auf Grund des Zustandes der Führanlage ernsthaft verletzen könne. Darin sah das OLG ein derart krasses Eigenverschulden, dass die Haftung wegen eines möglicherweise nicht verkehrssicheren Zustandes der Führanlage entfalle. Es sei ein klassischer Fall des "Verschuldens gegen sich selbst". Wörtlich meinte das OLG: "Es kann nur Kopfschütteln auslösen, wenn ein Pferdehalter die Anweisung erteilt, sein Tier in eine automatische Führanlage zu bringen, von der er genau weiß, dass sie sich in einem technisch so schlechten Zustand befindet, dass sein unbeaufsichtigtes Pferd sich dort ernsthaft verletzen kann". Dem ist nichts hinzuzufügen. Das OLG hat letztlich an die Eigenverantwortlichkeit des Pferdehalters erinnert. (Dr. Dietrich Plewa, Rechtsanwalt)