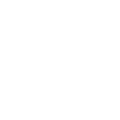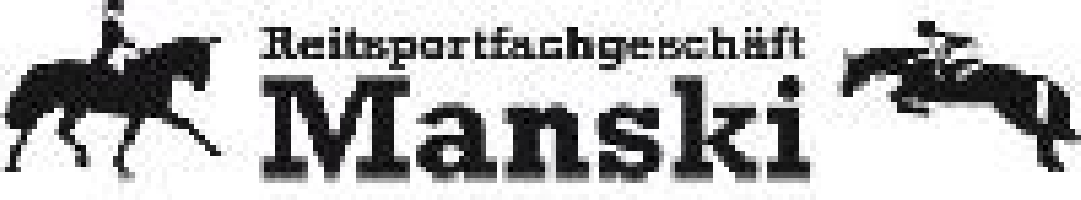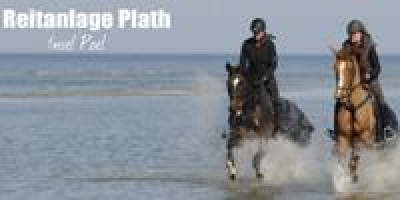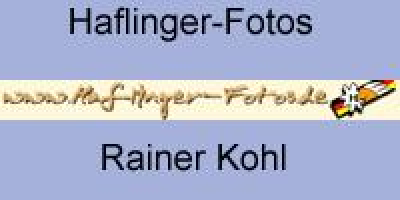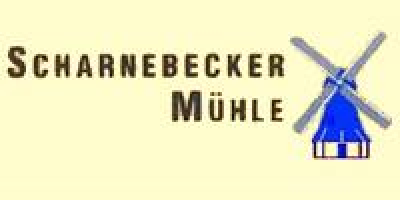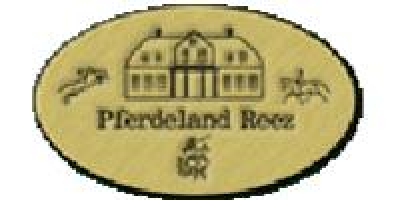Rechtsfälle: Honorar des Tierarztes
Erschienen am 07.11.2011
.jpg) Bekommt sein Honorar auch, wenn die Behandlung nicht erfolgreich ist?
Bekommt sein Honorar auch, wenn die Behandlung nicht erfolgreich ist?
Pferdeeigentümer sind oft der Meinung, sie brauchten jedenfalls dann den Tierarzt nicht zu bezahlen, wenn dessen Behandlung nicht erfolgreich war. Der Standpunkt ist nachvollziehbar, aus rechtlicher Sicht aber meistens falsch.
Anspruch auf tierärztliches Honorar
Als rechtlicher Grundsatz lässt sich feststellen: Der Auftraggeber hat das tierärztliche Honorar zu zahlen für die tatsächlich erbrachten Leistungen, auch wenn die durchgeführte Behandlung nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat.
Der Rechtsgrund für dieses Prinzip liegt darin, dass es sich beim Behandlungsvertrag, den der Pferdeeigentümer mit dem Tierarzt - meist mündlich - abschließt, ein Dienstvertrag ist. Danach schuldet der Tierarzt die Untersuchung und Behandlung des Pferdes, aber keinen Behandlungserfolg. Wird beispielsweise der Tierarzt wegen einer Lahmheit gerufen, so hat er das Pferd ordnungsgemäß zu untersuchen und nach den Regeln der veterinärmedizinischen Wissenschaft und Praxis zu behandeln. Führt aber letztlich die Therapie nicht zur Lahmfreiheit, muss der Auftraggeber zahlen, auch wenn das von ihm angestrebte Ergebnis nicht eingetreten ist.
Von dem erwähnten Grundsatz gibt es nur wenige Ausnahmen: Das tierärztliche Honorar ist dann nicht geschuldet, wenn die in Rechnung gestellten tierärztlichen Leistungen völlig unsinnig und von vornherein absolut ungeeignet waren, einen Therapieerfolg herbeizuführen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Behandlung auf einer eindeutigen Fehldiagnose beruht. Wird beispielsweise ein Hengst wegen einer Kolik behandelt, weil der Tierarzt eine Anschoppung festgestellt haben will, während tatsächlich ein Hodenbruch vorliegt, braucht die Kolikbehandlung nicht vergütet zu werden.
Eine weitere Ausnahme von der Verpflichtung, das tierärztliche Honorar bezahlen zu müssen, liegt dann vor, wenn die tierärztlichen Leistungen nur noch dem Zweck dient, einen vom Tierarzt schuldhaft herbeigeführten Schaden auszugleichen. Beispiel: Der Tierarzt hat einen eitrigen Abszess durch eine nicht ordnungsgemäß vorgenommene Injektion verursacht und behandelt danach das Pferd wegen der aufgetretenen Komplikation. In einem solchen Fall ist die Therapie reine Schadenswiedergutmachung.
Würde der Pferdeeigentümer einen anderen Tierarzt mit der Behandlung wegen des Abszesses beauftragen, hätte die hierfür entstehenden Behandlungskosten der vorbehandelnde Tierarzt zu erstatten. In diesem Fall könnte dann der Pferdehalter, mit seinem Schadensersatzanspruch gegenüber der Honorarforderung des erstbehandelnden Tierarztes aufrechnen.
Der Schadensersatzanspruch
Vielfach unterliegen Pferdeeigentümer dem Irrtum, jede nicht erfolgreiche Therapie begründe einen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Tierarzt. Die Auffassung ist schon im Ansatz verfehlt: Selbst wenn beispielsweise ein Pferd während einer Kolikoperation eingeschläfert werden muss, weil sich die Fortführung des Eingriffs als nicht Erfolg versprechend erweist, lässt sich aus dem Schaden, nämlich dem Verlust des Pferdes, nicht auf eine tierärztliche Pflichtverletzung schließen.
Der Tierarzt haftet immer nur dann, wenn ihm ein Behandlungsfehler unterläuft, der ursächlich wird für den eingetretenen Schaden. In einem aktuell vom Landgericht Frankenthal entschiedenen Rechtsstreit hat der Eigentümer eines Pferdes das tierärztliche Honorar nicht bezahlen wollen mit der Begründung, eine bei dem Pferd vorhandene Rehe sei vom Tierarzt nicht ordnungsgemäß behandelt worden. Der Vorwurf ging primär dahin, dass der Tierarzt nicht sofort nach Auftreten der Lahmheit Röntgenaufnahmen gefertigt habe. Mit diesem Argument hatte der Pferdehalter keinen Erfolg. Der Tierarzt hatte nämlich durchaus zutreffend eine Rehe diagnostiziert und das Pferd auch deswegen behandelt. Der vom Gericht eingeschaltete Sachverständige erklärte zwar, beim Verdacht einer Rehe sei es angezeigt, frühestmöglich Röntgenbilder anzufertigen. Dass dies in dem konkreten Fall unterblieben war, mag fehlerhaft gewesen sein, war aber für den weiteren Krankheitsverlauf nicht entscheidend. Der Tierarzt hatte nämlich die zutreffende Diagnose gestellt und das Pferd auch ordnungsgemäß wegen Rehe behandelt.
Die Beweislast
Will der Pferdeeigentümer Schadensersatz fordern, muss er den Behandlungsfehler darlegen und dessen Ursächlichkeit für den eingetretenen Schaden. In dem vom Landgericht Frankenthal entschiedenen Fall hatte der Tierarzt behauptet, den Auftraggeber nach seiner Diagnose "Hufrehe" aufgefordert zu haben, das Pferd in seine Klinik zu verbringen, um es dort intensiver beobachten und unter Hinzuziehung von Fachpersonal besser betreuen zu können.
Das Landgericht hob hervor, dass der Beklagte nachzuweisen habe, dass diese Angabe des Tierarztes unzutreffend war, dass also die Klinikempfehlung nicht ausgesprochen worden sei. Diesen Beweis hatte der Beklagte nicht führen können, so dass er letztlich das tierärztliche Honorar zu bezahlen hatte und seine auf Schadensersatz gerichtete Widerklage keinen Erfolg hatte.
Fazit
Von sehr seltenen Ausnahmen abgesehen schuldet der Auftraggeber des Tierarztes für eine Untersuchung und Behandlung seines Pferdes grundsätzlich das Honorar. Will der Pferdehalter Schadensersatz geltend machen, kann er gegenüber der Honorarforderung aufrechnen, muss dann allerdings eine tierärztliche Pflichtverletzung und die Ursächlichkeit für einen möglichen Schaden beweisen.
Dr. Dietrich Plewa
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht