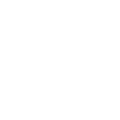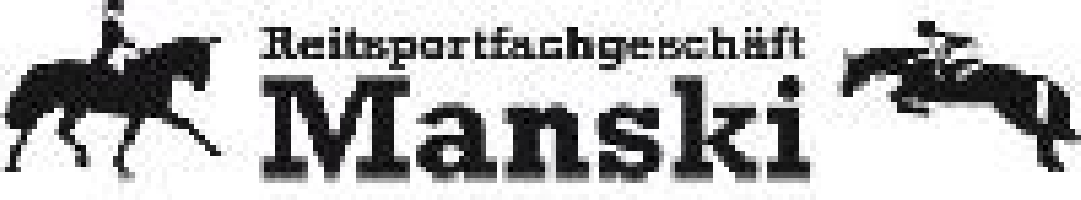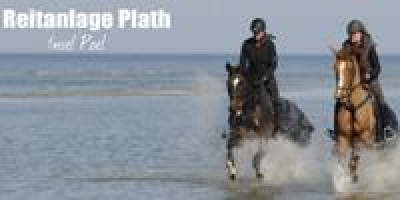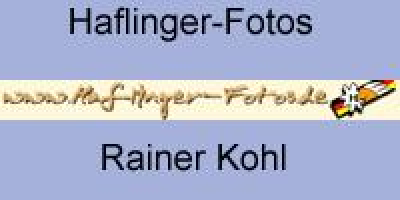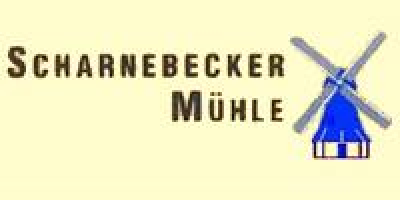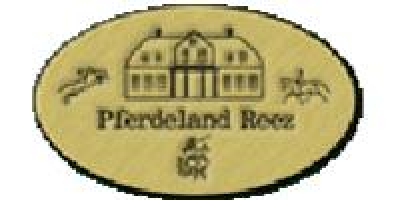Grundsätze zur Tierarzthaftung
Erschienen am 08.10.2013
 Wenn die Behandlung eines Pferdes nicht zur Zufriedenheit des Eigentümers verläuft, ist er oftmals geneigt, im Tierarzt den Schuldigen zu suchen. Es ist jedoch verfehlt, dem Tierarzt voreilig Vorwürfe zu machen. Die Haftung des Tierarztes ist an bestimmte rechtliche Voraussetzungen geknüpft, die in diesem Beitrag erörtert werden sollen.
Wenn die Behandlung eines Pferdes nicht zur Zufriedenheit des Eigentümers verläuft, ist er oftmals geneigt, im Tierarzt den Schuldigen zu suchen. Es ist jedoch verfehlt, dem Tierarzt voreilig Vorwürfe zu machen. Die Haftung des Tierarztes ist an bestimmte rechtliche Voraussetzungen geknüpft, die in diesem Beitrag erörtert werden sollen.
Ein Beispielfall
Das Pferd des Klägers in einem vom Landgericht Rottweil (LG) entschiedenen Fall hatte offensichtliche Probleme beim Urinieren. Der Stalltierarzt empfahl die Untersuchung in einer Tierklinik wegen des Verdachts eines Tumors oder auch eines Blasensteins. Der später verklagte Klinik-Tierarzt hat das Pferd eingehend untersucht, konnte aber einen Blasenstein ebenso wenig feststellen wie einen Tumor, wohl aber Anzeichen einer Kolik. Nach einer Schmerzbehandlung besserte sich der Zustand des Pferdes, ohne dass eine endgültige Heilung eingetreten wäre. Nach der Entlassung wurde das Pferd schließlich wegen derselben Problematik in einer anderen Tierklinik vorgestellt. Da wurde dann ein Blasenstein diagnostiziert und entfernt. Trotz intensiver Behandlung konnte das Pferd letztlich nicht gerettet werden, wurde vielmehr eingeschläfert.
Der Pferdeeigentümer verlangte Schadensersatz. Er wollte einen Großteil der Behandlungskosten und den Verlust des Pferdes ersetzt haben.
Die Voraussetzungen
Das LG hatte sich mit den Voraussetzungen für die tierärztliche Haftung auseinanderzusetzen. Insoweit gehen Pferdeeigentümer oftmals vorschnell davon aus, dass dann, wenn sich eine Komplikation oder gar der Tod eines Pferdes einstellen, den Tierarzt hierfür die rechtliche Verantwortung trifft. Dabei wird verkannt, dass es Krankheitsverläufe' gibt, die auch bei sehr sorgfältiger tierärztlicher Arbeit nicht mit dem Ergebnis einer endgültigen Heilung beeinflusst werden können.
In dem geschilderten Fall hatte der vom Gericht beauftragte Sachverständige festgestellt, dass in der erstbehandelnden Tierklinik ein Blasenstein keineswegs zwingend hatte festgestellt werden müssen. Das bedeutete dann aber auch, dass die weitere Behandlung ohnehin erforderlich war. Sie beruhte nicht etwa auf einem Diagnosefehler des erstbehandelnden Tierarztes. Das galt -dann insgesamt für den weiteren Krankheitsverlauf, letztlich ebenso für die Einschläferung des Pferdes.
So bedauerlich der Verlust für den Kläger auch war, so wenig ist das rechtliche Ergebnis zu beanstanden, nämlich die Abweisung der Klage.
Der Vertrag
Zwischen Pferdeeigentümer und Tierarzt wird regelmäßig ein Dienstvertrag abgeschlossen, kein Werkvertrag. Der Tierarzt schuldet keinen Behandlungserfolg, sondern lediglich ein "methodisch richtiges Vorgehen durch sorgfältige und gewissenhafte Untersuchung und Behandlung des
anvertrauten Tieres unter Einsatz der von einem gewissenhaften Veterinärmediziner zu erwartenden medizinischen Kenntnissen und Erfahrungen". Dies bedeutet: Der Tierarzt hat auch dann einen Anspruch auf sein Honorar, wenn seine Bemühungen nicht zu einer Heilung des Pferdes führen.
Er muss nach den Regeln der tierärztlichen Kunst Befunde erheben und auf deren Grundlage sorgfältig eine Diagnose stellen. Der mögliche Diagnosefehler führt allerdings nicht automatisch zu einer Haftung. Vielmehr muss auf diesem Fehler eine falsche Behandlung des Pferdes beruhen.
Der Behandlungsfehler ist die typische Pflichtverletzung, die zur Haftung eines Tierarztes führen kann. Diesen Behandlungsfehler muss allerdings zunächst einmal der Pferdeeigentümer nachweisen.
Der ursächliche Zusammenhang
Entscheidend ist dann weiter, dass zwischen der Pflichtverletzung des Tierarztes und dem eingetretenen Schaden ein ursächlicher Zusammenhang bestehen muss. Der liegt beispielsweise dann vor, wenn das Pferd bei ordnungsgemäßem Vorgehen des Tierarztes hätte gerettet werden können, also nicht hätte eingeschläfert werden müssen. Auch diesen Beweis hat grundsätzlich der Pferdeeigentümer zu erbringen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn dem Tierarzt ein grober Behandlungsfehler unterlaufen ist, wenn er also eine Pflichtverletzung begangen hat, die schlechterdings nicht vorkommen darf. Es muss ein eindeutiger Verstoß gegen bewährte tierärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte tiermedizinische Erkenntnisse vorliegen.
Der Kausalitätsnachweis
In dem geschilderten Fall war schon kein Diagnosefehler festgestellt worden. Erst recht aber - so das LG - habe der, Kläger nicht nachweisen können, dass bei einer anders artigen Behandlung die nachfolgenden Behandlungskosten nicht angefallen wären und das Pferd nicht später hätte eingeschläfert werden müssen. Die Klage hatte letztlich keinen Erfolg, weil der Kläger die rechtlichen Voraussetzungen für die Tierarzthaftung, nämlich die Pflichtverletzung und deren Ursache für den Verlust des Pferdes nicht hatte beweisen können.
Fazit
Aus einem Schaden kann nicht auf ein Verschulden des Tierarztes geschlossen werden. Vielmehr hat grundsätzlich der Pferdeeigentümer einen Behandlungsfehler und dessen Ursächlichkeit für den behaupteten Schaden nachzuweisen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn dem Tierarzt ein grober Verstoß gegen die zu fordernde Sorgfalt nachgewiesen werden kann.
Dr. Dietrich Plewa
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht