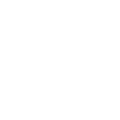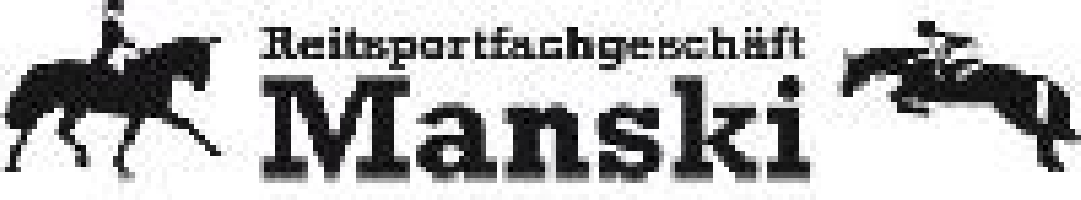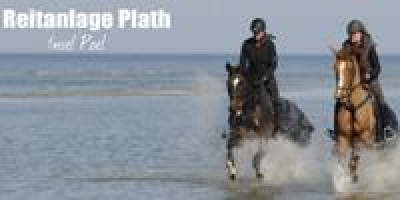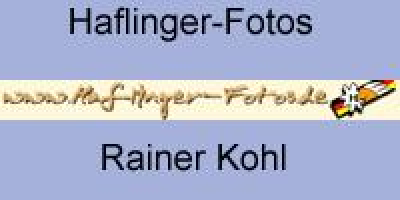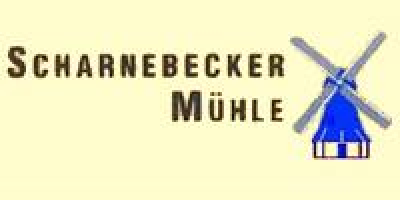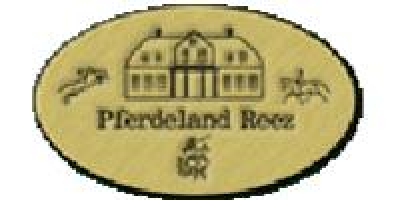Rechtsfragen: Auflösung einer Miteigentümereigenschaft
Erschienen am 30.01.2014
 Nicht selten hat ein Pferd nicht nur einen Eigentümer, sondern gleich mehrere. Man trifft insoweit sehr verschiedene Konstellationen an, beispielsweise das Miteigentum von Züchter und Reiter, von Sponsor und Ausbilder oder auch eine Miteigentümergemeinschaft, die von den Erben des verstorbenen Alleineigentümers gebildet wird. Zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt es oft, wenn die Gemeinschaft aufgelöst werden soll.
Nicht selten hat ein Pferd nicht nur einen Eigentümer, sondern gleich mehrere. Man trifft insoweit sehr verschiedene Konstellationen an, beispielsweise das Miteigentum von Züchter und Reiter, von Sponsor und Ausbilder oder auch eine Miteigentümergemeinschaft, die von den Erben des verstorbenen Alleineigentümers gebildet wird. Zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt es oft, wenn die Gemeinschaft aufgelöst werden soll.
Nicht empfehlenswert
Jahrelange Erfahrung mit Miteigentümergemeinschaften zeigen, dass oftmals Streit vorprogrammiert ist. Bei Turnieren entzündet sich der oftmals an der Frage, wo, wann und wie oft das Pferd eingesetzt werden soll. Ein Punkt von besonderer Brisanz ist dann letztlich ein möglicher Verkauf des Pferdes. Während ein Eigentümer der Auffassung ist, die erstbeste Chance nutzen zu wollen, hat vielleicht der andere die Vorstellung, in Zukunft ein noch besseres Gebot erhalten zu können. Konfliktstoff bietet darüber hinaus oftmals die Kostentragung. Der Streit bezieht sich dann etwa auf die Frage, welche tierärztlichen, insbesondere sportveterinärmedizinischen Maßnahmen sinnvoll, welche notwendig sind und welcher Aufwand insoweit betrieben werden soll.
Damit ist die Palette der Anknüpfungspunkte für Streitigkeiten zwischen den Miteigentümern nicht annähernd abschließend aufgezählt. Die Beispiele zeigen aber, dass es in jedem Falle sinnvoll ist, sich den Schritt, an einem Pferd gemeinschaftliches Eigentum zu bilden, sehr gut zu überlegen.
Wenn man sich dazu entschließt, sollten in jedem Fall die wesentlichen Punkte vertraglich, und zwar aus Beweisgründen schriftlich geklärt sein. Insbesondere sollte eine Regelung in einen solchen Vertrag aufgenommen werden, der die Beendigung der Miteigentümergemeinschaft regelt.
Das Gesetz
Eine Mehrheit von Miteigentümern an einem Pferd bildet rechtlich eine Gemeinschaft im Sinne des BGB. Das Gesetz sieht vor, dass jedes Mitglied der Gemeinschaft jederzeit die Auflösung verlangen kann. Die erfolgt dann durch "Verwertung", also durch Verkauf des gemeinsamen Eigentums. Unproblematisch ist der dann, wenn ein Eigentümer lediglich aussteigen will und der andere bereit ist, den verlangten Preis für den Miteigentumsanteil zu zahlen, um dadurch Alleineigentümer zu werden. Besteht kein Kaufinteresse des Miteigentümers, müsste das Pferd an einen Dritten verkauft werden. Weigert sich ein Miteigentümer, an dem Verkauf mitzuwirken, kann er auf Zustimmung verklagt werden. Ob das im Ergebnis nützlich ist, erscheint fraglich. Selbst wenn die Zustimmung dann - notfalls durch gerichtliches Urteil - erteilt ist, stellt sich die Frage, zu welchem Preis das Pferd angeboten und letztlich verkauft werden soll. Der sich weigernde Miteigentümer nimmt dann oftmals eine Blockadehaltung ein, kümmert sich selbst nicht um die Veräußerung oder behindert sie gar.
Dann bleibt noch eine weitere Alternative: Der Miteigentümer, der die Auflösung der Gemeinschaft wünscht, kann von dem anderen oder den anderen die Zustimmung verlangen, dass das Pferd veräußert wird im Wege der Versteigerung durch einen Gerichtsvollzieher. Dieser Art der Auseinandersetzung kann sich letztlich der die Veräußerung ablehnende Miteigentümer nicht mit Erfolg widersetzen. Die Vorgehensweise ist allerdings mit Kosten verbunden, weil der Gerichtsvollzieher selbst ein Honorar beansprucht und darüber hinaus in der Regel durch einen Sachverständigen zunächst einmal den Wert des Pferdes ermitteln lässt, sofern die Miteigentümer nicht übereinstimmend einen bestimmten Wert angeben.
Einwand: Unterhaltungskosten
Befand sich das Pferd bis zur Veräußerung in der Obhut eines der Miteigentümer, wird der oftmals geltend machen, ihm stünden Ansprüche gegenüber den anderen Miteigentümern auf Erstattung von Unterstellungs-, Ausbildungs- und sonstigen Unterhaltungskosten zu. Tatsächlich haben, wenn nichts anderes vereinbart ist, die Miteigentümer diese Aufwendungen im Verhältnis ihrer jeweiligen Miteigentumsanteile zu tragen. Allerdings steht demjenigen, der mit den Kosten in Vorlage getreten ist, nach der Rechtsprechung kein Zurückbehaltungsrecht zu. Er kann aber nicht etwa argumentieren, einer Veräußerung des Pferdes erst zuzustimmen, wenn die Unterhaltungskosten erstattet sind, anderenfalls - so zuletzt das AG Velbert - hätte der Miteigentümer die Möglichkeit, die Auseinandersetzung der Miteigentümergemeinschaft durch Verkauf schlicht zu verhindern. Der Miteigentümer sei vielmehr darauf zu verweisen, seinen Anspruch aus dem Versteigerungserlös erfüllen zu lassen.
Fazit:
Wenn man sich entschließt, einen Eigentumsanteil an einem Pferd zu erwerben und eine Miteigentümergemeinschaft zu gründen, sollten alle Modalitäten einschließlich derjenigen für die Auflösung der Gemeinschaft möglichst exakt fixiert werden.
Dr. Dietrich Plewa (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht)