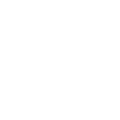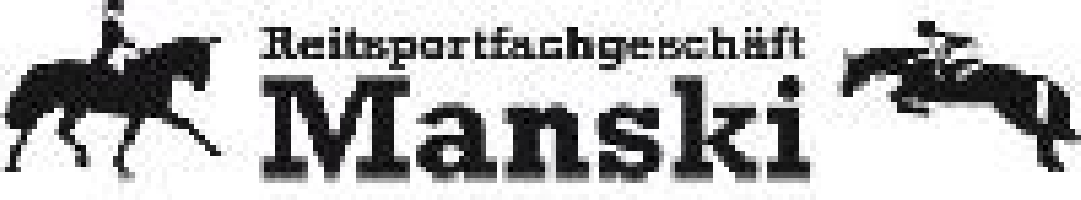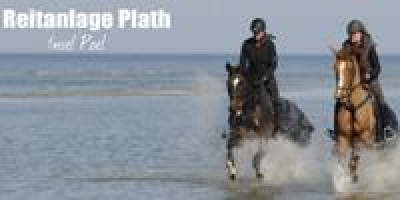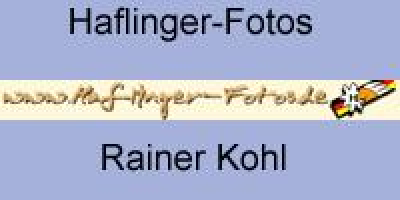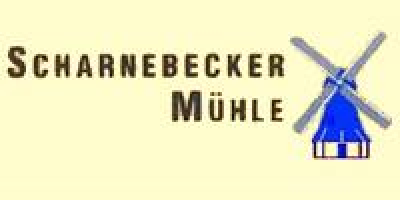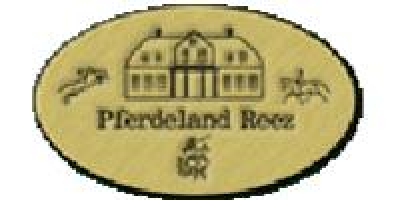Haftung des Hufschmiedes
Erschienen am 20.11.2014
 Wenn in der Folge eines fehlerhaften Beschlages eine Lahmheit auftritt, hat der Hufschmied die Tierarztkosten zu tragen. Allerdings scheitert der Schadensersatzanspruch manchmal daran, dass der Pferdeeigentümer den ursächlichen Zusammenhang zwischen fehlerhaftem Beschlag und der Lahmheit nicht nachweisen kann.
Wenn in der Folge eines fehlerhaften Beschlages eine Lahmheit auftritt, hat der Hufschmied die Tierarztkosten zu tragen. Allerdings scheitert der Schadensersatzanspruch manchmal daran, dass der Pferdeeigentümer den ursächlichen Zusammenhang zwischen fehlerhaftem Beschlag und der Lahmheit nicht nachweisen kann.
Ein Beispielsfall
Die Problematik wird deutlich an einem Rechtsstreit, der in 2. Instanz vom Landgericht Wiesbaden (LG) entschieden wurde.
Über mehrere Jahre hinweg war ein Pferd der Klägerin beschlagen worden, ohne dass es jemals Probleme gegeben hat. Der Beklagte, der erstmals mit dem Beschlag betraut worden war, hatte neue Eisen aufgebracht. Danach hatte eine Zeugin einen klammen Gang des Pferdes beobachtet. Wiederum einen Tag später stellte der hinzugezogene Tierarzt eine Huflederhautentzündung vorne beiderseits fest. Ein anderer Hufschmied, der die neu aufgebrachten Eisen abgenommen hatte, war der Auffassung, der Tragrand sei zu stark gekürzt worden, außerdem sei die sogenannte weiße Linie verbrannt gewesen. Der Tierarzt meinte dagegen, dass die Huflederhautentzündung zwar auf den Beschlag zurückzuführen sein könne, er könne aber im Nachhinein nicht sagen, ob das Kürzen des Tragrandes und ein zu starkes Ausschneiden der Hufsohle zu der Erkrankung geführt habe.
Wenn der Pferdeeigentümer wegen der Folgen eines fehlerhaften Beschlages Schadensersatzansprüche geltend machen will, muss er zunächst eine Pflichtverletzung nachweisen.
Als solche kommt typischerweise ein Vernageln in Betracht. Ebenso fehlerhaft ist allerdings, die Hufe zu stark zu kürzen, weil hierdurch u.a. eine Huflederhautentzündung oder eine Rehe verursacht werden kann.
Der Schaden besteht dann regelmäßig darin, dass wegen einer Lahmheit des Pferdes ein Tierarzt mit der Behandlung betraut wird. Die tierärztlichen Behandlungskosten sind ebenso wie eine eventuell verbleibende Wertminderung Gegenstand der Schadensersatzforderung.
Entscheidender Knackpunkt ist jedoch die Beweislast: Der Pferdeeigentümer muss den Beweis führen, dass die Pflichtverletzung, also das Vorgehen des Hufschmiedes, ursächlich geworden ist für die bei dem Pferd nach dem Beschlag festgestellte Lahmheit.
Zum Fall
In 1. Instanz hatte das Amtsgericht (AG) schon wegen der zeitlichen Nähe des Auftretens der Lahmheit zum Beschlag angenommen, dass tatsächlich das Vorgehen des Hufschmiedes die Huflederhautentzündung verursacht hatte. Dafür sprach nach Auffassung des Gerichts insbesondere der Umstand, dass direkt nach dem Beschlag ein klammer Gang beobachtet worden war und der hinzugezogene - andere - Hufschmied berichtet hatte, die Sohle sei zu stark ausgeschnitten gewesen, der Tragrand zu deutlich gekürzt und die weiße Linie verbrannt.
Dem LG reichten die Zeugenaussagen zur Überzeugungsbildung nicht. Es wurde ein Sachverständiger beauftragt. Der meinte, dass es durchaus sein könne, dass eine Pflichtverletzung des Hufschmiedes die Huflederhautentzündung verursacht habe. Andererseits könne eine solche Huflederhautentzündung aber auch andere Ursachen haben. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Hufschmied am Tag der Ausführung des Beschlages eine Huflederhautentzündung noch nicht bemerkt habe.
Das LG hat dann letztlich die Klage abgewiesen.
Fazit
Rechtsstreitigkeiten werden manchmal streng nach Beweislastgrundsätzen entschieden. Dabei sind die eingeholten Gutachten nicht immer hilfreich, weil sich manche Sachverständige nicht in der Lage sehen, sich auf der Grundlage lebensnaher Betrachtungen in eine bestimmte Richtung festzulegen oder zumindest einen Wahrscheinlichkeitsgrad anzugeben. Zur Überzeugung des Gerichts genügt es nicht, dass die behauptete Pflichtverletzung überwiegend wahrscheinlich ist, vielmehr müsste der Gutachter zumindest zu dem Ergebnis kommen, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Vorgehensweise des Schmiedes den Schaden verursacht hat.
Dr. Plewa / Dr. Schliecker Rechtsanwälte