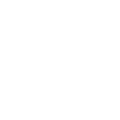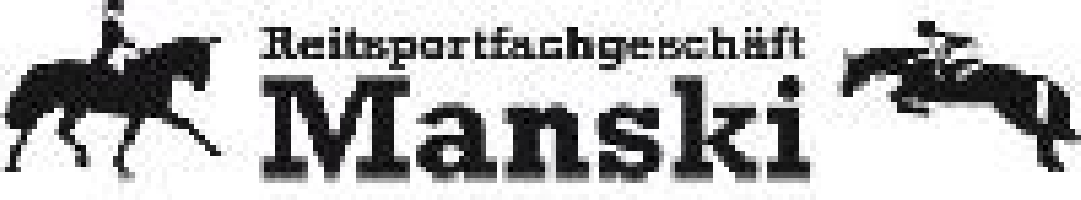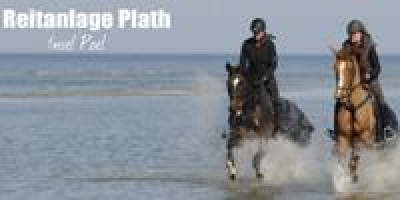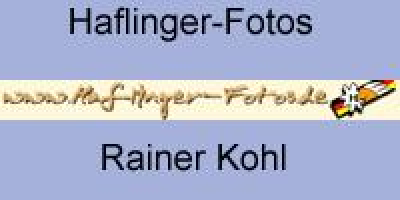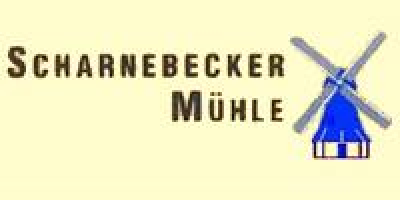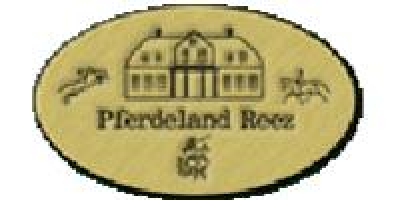SALVANA: Fütterung laktierender Stuten
Erschienen am 28.02.2012

Die Milchleistung der Stute fällt unter ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten unter "Hochleistungsport". Foto: Jutta Wego
"Die Milch macht´s auch beim Pferd"
( von Dr. Ernst Stephan, SALVANA, Elmshorn)
Die Milchleistung der Stute fällt unter ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten unter "Hochleistungsport". Die enorme Leistung, die die Stute erbringt, muss auch durch einen entsprechenden Futternachschub sichergestellt werden. Mit der Geburt des Fohlens beginnt die Stute, Milch in ihrem Euter zu bilden. In der Regel verbleibt das Fohlen 6 Monaten bei der Stute. In dieser Zeit muss die Stute für das Fohlen die Milch produzieren. Erst mit dem Absetzen des Fohlens versiegt die Milchproduktion der Stute, da der Reiz durch das Fohlen nicht mehr vorhanden ist. In diesen 6 Monaten kann eine Stute (ca. 600 kg Lebendgewicht) insgesamt zwischen 2.500 und 3.000 kg Milch produzieren. Die Milchmenge, die die milchgebende (laktierende) Stute in ihrem Euter bildet, ist nicht jeden Tag gleich.
Nicht jeden Tag die gleiche Menge Milch im Euter
Aus der Graphik ist zu erkennen, das z.B. eine Stute (600 kg Lebendgewicht) im 1. Monat der Laktation pro Tag ca. 16 bis 17 kg Milch gibt, während sie im 3. Monat den maximalen Wert von 20 bis 21 kg erreicht hat und im 5. Laktationsmonat bereits wieder unterhalb der Menge vom 1. Monat liegt. Um die tägliche Milchmengenleistung zu verdeutlichen, muss man sich nur täglich 1 bis 2 Wassereimer randvoll mit Milch vorstellen. Die Angabe der Milchmengenleistung erfolgt in Kilogramm (kg) und nicht in Liter. Dabei ist zu beachten, dass auf Grund des spezifischen Gewichtes der Stutenmilch, ein Liter Milch nicht gleich einem Kilogramm (kg) Milch entspricht.
 Stuten großer Pferderassen geben absolut (kg) entsprechend mehr Milch und Stuten kleiner Rassen entsprechend weniger. Die unterschiedliche Milchmengeleistung der Stute ist bei der praktischen Rationsgestaltung zu berücksichtigen. Die Inhaltstoffe, die über die Milch abgegeben werden, müssen wieder über das Futter der Stute zu geführt werden.
Stuten großer Pferderassen geben absolut (kg) entsprechend mehr Milch und Stuten kleiner Rassen entsprechend weniger. Die unterschiedliche Milchmengeleistung der Stute ist bei der praktischen Rationsgestaltung zu berücksichtigen. Die Inhaltstoffe, die über die Milch abgegeben werden, müssen wieder über das Futter der Stute zu geführt werden.
Was ist drin in der Stutenmilch?
 Nicht nur die Milchmengenleistung verändert sich während der Laktation von Tag zu Tag, sondern auch die Gehalte an wertvollen Inhaltstoffen wie Energie, Eiweiß, Vitaminen, Mengen- und Spurenelemente. Wer selbst schon einmal Stutenmilch probiert hat, weiß, dass sie süß und wässrig schmeckt. Dies soll nicht abwertend gemeint sein, sondern es liegt daran, dass die Menschen den Geschmack der Stutenmilch mit dem bereits bekannten Geschmack der Kuhmilch vergleichen. Die Gehalte der Stutenmilch hat die Natur auf den Bedarfs des Fohlens abgestimmt und nicht auf die Geschmacksvorliebe des Menschen. Eine Gegenüberstellung der verschiedenen Gehalte der Inhaltsstoffe von Stuten- und Kuhmilch zeigt deren genauen Unterschiede auf (Tabelle 1).
Nicht nur die Milchmengenleistung verändert sich während der Laktation von Tag zu Tag, sondern auch die Gehalte an wertvollen Inhaltstoffen wie Energie, Eiweiß, Vitaminen, Mengen- und Spurenelemente. Wer selbst schon einmal Stutenmilch probiert hat, weiß, dass sie süß und wässrig schmeckt. Dies soll nicht abwertend gemeint sein, sondern es liegt daran, dass die Menschen den Geschmack der Stutenmilch mit dem bereits bekannten Geschmack der Kuhmilch vergleichen. Die Gehalte der Stutenmilch hat die Natur auf den Bedarfs des Fohlens abgestimmt und nicht auf die Geschmacksvorliebe des Menschen. Eine Gegenüberstellung der verschiedenen Gehalte der Inhaltsstoffe von Stuten- und Kuhmilch zeigt deren genauen Unterschiede auf (Tabelle 1).
Der wässrige Geschmack der Stutenmilch kommt dadurch zu Stande, dass die Kuhmilch einen höheren Trockensubstanzgehalt hat als die Stutenmilch. Dies bedeutet, dass die Stutenmilch mehr Wasser als die Kuhmilch hat und damit folglich auch "wässriger" schmeckt. Bekanntermaßen hat auch der Fettgehalt einen Einfluss auf den Geschmack. Milch mit einem hohen Fettgehalt schmeckt vollmundig. Mit durchschnittlich vier Prozent Fettgehalt hat die Kuhmilch einen weit höheren Fettgehalt als die Stutenmilch. Der höhere Gehalt an Milchzucker (Laktose) in der Stutenmilch ist für den süßen Geschmack verantwortlich. An den Unterschieden zwischen Stuten- und Kuhmilch wird auch sehr deutlich, dass ein Milchaustauscher für Kälber niemals bei Fohlen eingesetzt werden darf. Der Milchaustauscher für Kälber ist an die Zusammensetzung der Kuhmilch ausgerichtet und nicht an die der Stutenmilch.
Weiterhin ist erkennbar, dass sich die Gehalte der Stutenmilch im Verlauf der Laktation verändern. Der Rohprotein- und Fettgehalt nehmen im Verlauf der Laktation kontinuierlich ab, so dass sich auch der Energiegehalt verringert. Allein der Milchzuckergehalt bleibt auf nahezu gleichem Niveau. Die Gehalte der Inhaltsstoffe in der Stutenmilch können auch über die Art und Weise der Fütterung beeinflusst werden. Durch eine aminosäurenreduzierte Fütterung der Stute während der Laktation kann der Rohproteingehalt in der Stutenmilch abgesenkt werden. Die Rationsgestaltung der laktierenden Stute muss an die individuelle Leistung der Stute ausgerichtet werden. Wer dies alles leisten will, muss auch entsprechend ernährt werden, zumal auch zu diesem Zeitpunkt die Weichen für die nächste Trächtigkeit gestellt werden.
Trockensubstanzaufnahme steht für Futteraufnahme
 Eine fundierte Rationsplanung umfasst als erstes die Kenntnis der Höhe der Futteraufnahme der laktierenden Stute. Bevor man sich über die Größenordnung der lebenswichtigen Nähr- und Zusatzstoffe unterhält, muss bekannt sein, warum und wie viel eine laktierende Stute am Tag frisst. Damit besteht bereist im Vorfeld die Möglichkeit, Über- und auch Unterversorgungen der Stute zu vermeiden. Die Höhe und damit Steuerung der Futteraufnahme wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, die futterbedingter - chemischer, physikalischer - bzw. tierbedingter Natur sind. Die Höhe der Trockensubstanzaufnahme beschreibt ideal die Höhe der Futteraufnahme beim Pferd. Einige Futtermittel für Pferde können sehr unterschiedliche Trockensubstanzgehalte aufweisen. Junges Gras besitzt z.B. in der Regel nur einen Trockensubstanzgehalt von 16 Prozent, während der Hafer bei Trockensubstanzgehalt von ca. 86 bis 88 Prozent liegt.
Eine fundierte Rationsplanung umfasst als erstes die Kenntnis der Höhe der Futteraufnahme der laktierenden Stute. Bevor man sich über die Größenordnung der lebenswichtigen Nähr- und Zusatzstoffe unterhält, muss bekannt sein, warum und wie viel eine laktierende Stute am Tag frisst. Damit besteht bereist im Vorfeld die Möglichkeit, Über- und auch Unterversorgungen der Stute zu vermeiden. Die Höhe und damit Steuerung der Futteraufnahme wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, die futterbedingter - chemischer, physikalischer - bzw. tierbedingter Natur sind. Die Höhe der Trockensubstanzaufnahme beschreibt ideal die Höhe der Futteraufnahme beim Pferd. Einige Futtermittel für Pferde können sehr unterschiedliche Trockensubstanzgehalte aufweisen. Junges Gras besitzt z.B. in der Regel nur einen Trockensubstanzgehalt von 16 Prozent, während der Hafer bei Trockensubstanzgehalt von ca. 86 bis 88 Prozent liegt.
Frisst ein Pferd am Tag u.a. 4 kg Hafer, dann sind dies rechnerisch ca. 3,5 kg Trockensubtanz (87 Prozent von 4 kg = 3,5 kg). Würde das Pferd die entsprechende Menge Trockensubstanz (3,5 kg) in Form von jungem Gras fressen, wären dies nicht 4 kg wie beim Hafer, sondern fast 22 kg Gras (16 Prozent von 22 kg = ca. 3,5 kg). Daraus wird deutlich, wie wichtig die Kenntnis der Trockensubstanzaufnahme beim Pferd ist, um verschiedene Rationstypen gerade in der Weidesaison miteinander zu vergleichen. Im Verlauf der Laktation verändert sich die tägliche Trockensubstanzaufnahme. Es ist davon auszugehen, dass die absolute TS-Aufnahme vom 1. über den 2. bis zum 3. Laktationsmonat ansteigt, um dann im 5. Monat unter den Ausgangswert zu fallen. Mit der Veränderung der Futteraufnahme müssen gleichzeitig die Anforderungen an die Nährstoffkonzentration angepasst werden. Die Angabe der Energiedichte in Form der Energiekonzentration in der Trockensubstanz (MJ DE je kg TS) stellt hierfür ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung einer Tagesration für laktierende Stuten dar.
Die mineralische Versorgung sollte alle Spuren- bzw. Mengenelemente und Vitamine umfassen. Entweder wird ein Mineralfutter oder ein voll mineralisiertes Ergänzungsfutter eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass die empfohlene Einsatzmenge auch wirklich immer verfüttert wird, da es ansonsten zu einer mineralischen Unterversorgung kommen kann, wenn z.B. nur die Hälfte des Ergänzers in die Krippe gelangt. Die Versorgungsempfehlungen für laktierende Stuten sind in der Tabelle 2 aufgelistet und bieten Eckpunkte für die Erstellung und Interpretation einer Rationsberechnung für die Stuten. Arbeiten die Stuten während der Laktation, müssen die Versorgungsempfehlungen entsprechend erhöht werden.
Der Energiebedarf von laktierenden Stuten nimmt bis zum 3. Laktationsmonat zu, um dann deutlich abzufallen. Die Angabe der Energiedichte in Form der Energiekonzentration in der Trockensubstanz (MJ DE je kg TS) bleibt im 1. und im 3. Laktationsmonat auf gleichem Niveau, während sie im 5. Laktationsmonat deutlich verringert ist.
 Bisher wurden Empfehlungen für die Versorgung der laktierenden Stuten mit verdaulichem Rohprotein (vRp) ausgesprochen. Die Stuten haben jedoch keinen Eiweißbedarf, sondern einen Bedarf an verschiedenen Aminosäuren. Die verschiedenen Aminosäuren sind die Bausteine des Eiweißes. Überschüssiges Eiweiß muss über die Leber von der Stute "entgiftet" werden. Dies kostet Energie und ist damit sehr aufwändig. Bei Haltung mit einer geringen Weidenutzung ist es sinnvoll, die Stute gezielt mit verschiedenen Aminosäuren zu versorgen. Für die gesamte Laktation wird seitens der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) ein einheitlicher Mineralstoffbedarf angenommen. Grundsätzlich ist jedoch von einem Abfall des Mineralstoffbedarfs von 3. bis zum 5. Laktationsmonat auszugehen.
Bisher wurden Empfehlungen für die Versorgung der laktierenden Stuten mit verdaulichem Rohprotein (vRp) ausgesprochen. Die Stuten haben jedoch keinen Eiweißbedarf, sondern einen Bedarf an verschiedenen Aminosäuren. Die verschiedenen Aminosäuren sind die Bausteine des Eiweißes. Überschüssiges Eiweiß muss über die Leber von der Stute "entgiftet" werden. Dies kostet Energie und ist damit sehr aufwändig. Bei Haltung mit einer geringen Weidenutzung ist es sinnvoll, die Stute gezielt mit verschiedenen Aminosäuren zu versorgen. Für die gesamte Laktation wird seitens der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) ein einheitlicher Mineralstoffbedarf angenommen. Grundsätzlich ist jedoch von einem Abfall des Mineralstoffbedarfs von 3. bis zum 5. Laktationsmonat auszugehen.
Veränderte Futtergrundlage während der Weidesaison
Der Start in die Weidesaison muss für Stute und Fohlen schonend erfolgen. Da sich der gesamte Verdauungsapparat erst auf die "neuen" Futtermittel einstellen muss, sind bekanntermaßen abrupte Futterumstellungen für das Pferd nie von Vorteil. Doch wie viel Gras frisst meine Stute am Tag? Dieser Wert ist von großer Bedeutung, da danach die weitere Ergänzung erfolgen muss. Im Stall war es kein Problem, da man wusste, wie viel Grundfutter in Form von Heu bzw. Silage die Stute erhalten hat.
Die Größenordnung der Grasaufnahme ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Dazu gehören u.a. das Alter des Aufwuchses (TS-Gehalt des Grases), die Qualität der Weide und die eigentliche Weidedauer, die der Pferdehalter festlegt. Mit Hilfe von Richtwerten zur durchschnittlichen TS-Aufnahme von Weidegras je Stunde Weidegang kann die Gesamtmenge an Weidegras, die die Stute frisst abgeschätzt werden und für die praktische Rationsberechnung verwendet werden.
Beispielsrationen für laktierende Stuten
Aufgrund des sehr hohen Energiebedarfs ist eine sehr hohe Kraftfuttermenge pro Stute und Tag notwendig. Dies bedeutet für die praktische Fütterung, dass die gesamte Kraftfuttermenge über mehrere Mahlzeiten am Tag aufgeteilt werden muss, um Verdauungsprobleme im Vorfeld zu vermeiden. Kurz vor der Geburt ist die gesamte Futtermenge reduziert worden, damit das Futter im Verdauungskanal nicht zu viel Platz einnimmt. Nach der Geburt des Fohlens muss die Kraftfuttermenge anfänglich etwas verzögert, aber dennoch kontinuierlich gesteigert werden, so dass nach ein bis spätestens zwei Wochen die volle Futtermenge gefüttert werden kann.
 Während der Weidsaison ist die Beifütterung der Stuten von sehr großer Bedeutung, da sie ergänzen muss, was die Weide nicht liefert. Gerade das junge frische Gras ist zwar sehr schmackhaft, aber auch sehr strukturarm. Eine Zufütterung von Heu bzw. Stroh kann hier den Strukturmangel ausgleichen und bei eingeschränkter Weidezeit die Pferde auch sättigen. Bei allen Rationsberechnungen muss darauf geachtet werden, dass die notwendige Energiedichte in Form der Energiekonzentration in der Trockensubstanz (MJ DE je kg TS) eingehalten wird. Bei Stuten im 1. und 3. Laktationsmonat sollte sie bei ca. 11 MJ je kg TS liegen, um eine energetische Unterversorgung zu vermeiden. Ein Energiemangel wäre nicht nur für das säugende Fohlen, sondern auch für die Fruchtbarkeit der Stute von großem Nachteil.
Während der Weidsaison ist die Beifütterung der Stuten von sehr großer Bedeutung, da sie ergänzen muss, was die Weide nicht liefert. Gerade das junge frische Gras ist zwar sehr schmackhaft, aber auch sehr strukturarm. Eine Zufütterung von Heu bzw. Stroh kann hier den Strukturmangel ausgleichen und bei eingeschränkter Weidezeit die Pferde auch sättigen. Bei allen Rationsberechnungen muss darauf geachtet werden, dass die notwendige Energiedichte in Form der Energiekonzentration in der Trockensubstanz (MJ DE je kg TS) eingehalten wird. Bei Stuten im 1. und 3. Laktationsmonat sollte sie bei ca. 11 MJ je kg TS liegen, um eine energetische Unterversorgung zu vermeiden. Ein Energiemangel wäre nicht nur für das säugende Fohlen, sondern auch für die Fruchtbarkeit der Stute von großem Nachteil.
Obwohl jeder Züchter seine laktierende Stute individuell beurteilt und danach füttert, soll an einigen Rationsbeispielen der Schwerpunkt der Fütterungsempfehlungen für laktierenden Stuten in Tabelle 3 und 4 verdeutlicht werden. Diese Rationsberechnungen können keine individuelle Rationsempfehlung ersetzen, da die Futtergrundlage von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein kann. Im 3. Laktationsmonat ist die täglich produzierte Milchmenge am höchsten, so dass dann auch am meisten Energie von der Stute benötigt wird.
Grundvoraussetzung ist natürlich, dass alle verwendeten Futtermittel hygienisch einwandfrei sind und von hoher Qualität. Die Ernährung der laktierenden Stute und damit auch indirekt des Saugfohlens ist für jeden Züchter immer wieder eine große Herausforderung, die Erfahrung verlangt.