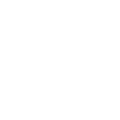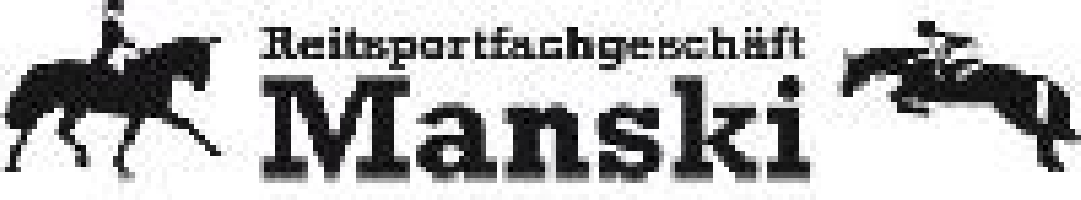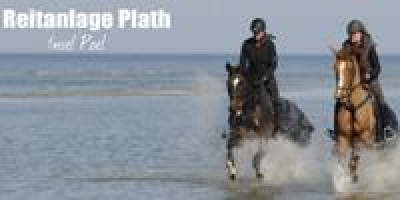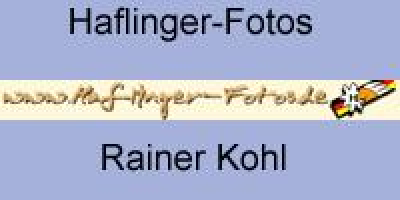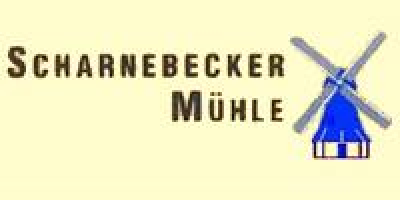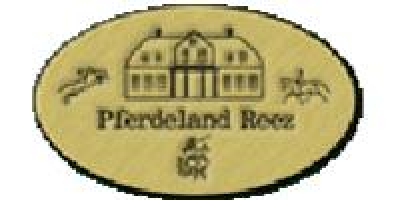Recht: Beschaffenheitsvereinbarung beim Pferdekauf
Erschienen am 10.12.2010

Pferdekauf: Die Beschaffenheitsvereinbarung
Seit zum 01.01.2002 das neue Kaufrecht in Kraft getreten ist, ist immer wieder von vereinbarter „Beschaffenheit" die Rede. Dieser Beitrag befasst sich mit der Bedeutung des Begriffs.
Die Gesetzeslage
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) stellt in § 434 für die Feststellung eines Mangels primär auf die vereinbarte Beschaffenheit ab. Ein Pferd ist dann mit einem Sachmangel behaftet, wenn es der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit nicht entspricht.
Ganz allgemein versteht man unter der Beschaffenheit die von den Vertragsparteien übereinstimmend zu Grunde gelegten Eigenschaften eines Pferdes, die reichen von Abstammung, Alter und Rasse bis hin zu Turniererfolgen oder auch Charaktereigenschaften.
Wenn eine Beschaffenheit überhaupt vereinbart ist, kommt es entscheidend für die Feststellung eines Mangels auf den Inhalt dieser Vereinbarung an.
In einem sehr häufig verwendeten Vertragsformular heißt es sinngemäß, dass das Ergebnis der tierärztlichen Kaufuntersuchung (TÜV) die gesundheitliche Beschaffenheit des verkauften Pferdes bestimmen soll. Das mitgeteilte Untersuchungsergebnis wird dadurch Inhalt des Kaufvertrages.
Die Rechtsfolgen
Ist keine Beschaffenheit vereinbart, kommt es für die Feststellung eines Sachmangels darauf an, ob das Pferd sich für den vertraglich vereinbarten Verwendungszweck eignet. Ist auch dazu keine Verabredung zwischen Käufer und Verkäufer getroffen worden, ist festzustellen, ob das Pferd der „üblichen", von einem durchschnittlichen Pferd vergleichbarer Kategorie zu erwartenden Beschaffenheit entspricht oder aber einen Fehler aufweist, von dem der Käufer erwarten darf, dass ein Pferd einen solchen Fehler nicht hat. Die Haftung des Verkäufers wird auf dieser Stufe der rechtlichen Überprüfung sehr weit. Gerade deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, eine Beschaffenheit zu vereinbaren, um hierüber die Haftung des Verkäufers für die Sachmängel einzuschränken.
Dennoch ergibt sich gerade dann ein Risiko, wenn das Ergebnis der tierärztlichen Kaufuntersuchung die gesundheitliche Beschaffenheit bestimmen soll. Dann nämlich hat der Verkäufer auch für solche Befunde einzustehen, die der Tierarzt bei der Kaufuntersuchung schlicht übersehen hat. Mehr noch: Selbst Befunde, die ansonsten gar keinen Sachmangel darstellen würden, reichen dann aus, um den Rücktritt vom Vertrag zu erklären.
So hat beispielsweise der BGH entschieden, dass Röntgenbefunde der Klasse II bis III normalerweise keinen Sachmangel darstellen, es sei denn, sie wären bereits klinisch relevant oder bei vergleichbaren Pferden völlig unüblich. Ist also beispielsweise das Pferd nicht lahm, obwohl es einen Chip aufweist, der in die Röntgenklasse II bis III einzustufen ist, wird von den Gerichten regelmäßig das Vorliegen eines Sachmangels verneint. Etwas anders gilt aber, wenn der Tierarzt im Rahmen der Kaufuntersuchung diesen Chip nicht erwähnt hat, aber seinUntersuchungsergebnis die gesundheitliche Beschaffenheit bestimmen soll. Dann nämlich reicht jede Abweichung von dem attestierten Gesundheitszustand des Pferdes aus, um einen Sachmangel zu begründen.
Das ist zuletzt durch das OLG Karlsruhe bestätigt worden.
Der Fall:
Der die Kaufuntersuchung durchführende Tierarzt hatte keinerlei Röntgenbefunde erhoben. Wenige Tage nach Übergabe war das Pferd lahm. Festgestellt wurden als Ursache Röntgenbefunde der Klasse II bis III.
Das Landgericht hielt dem vom Käufer erklärten Rücktritt für wirksam, weil das Pferd im Gegensatz zum mitgeteilten Untersuchungsergebnis der Kaufuntersuchung nicht der Röntgenklasse I entsprach.
Diese Auffassung wurde vom OLG Karlsruhe bestätigt.
Ein Sachmangel sei schon deswegen anzunehmen, weil kurze Zeit nach Übergabe das Pferd lahmte und hierfür keine akute Ursache festgestellt werden konnte. Insoweit kam der Klägerin des Rechtsstreits zu Gute, dass der Verkäufer gewerblich gehandelt hatte. Das OLG meinte daher, dass § 476 BGB anzuwenden sei und der Verkäufer zu widerlegen habe, dass das Pferd bei Gefahrübergang lahmfrei war.
Daneben allerdings stellte auch das OLG darauf ab, dass die Parteien vereinbart hätten, dass das Pferd röntgenologisch entsprechend dem Inhalt des Kaufuntersuchungsprotokolls keinerlei Röntgenbefunde aufweise. Es komme deswegen auch nicht darauf an, ob das Pferd „nur" Röntgenbefunde der Klasse II bis III habe, die ansonsten gar keinen Mangel darstellen würden. Vielmehr reiche die Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit.
Das Ergebnis
Bezieht man in den Kaufvertrag eines Pferdeskaufes das Ergebnis der Kaufuntersuchung in der Weise ein, dass es die gesundheitliche Beschaffenheit bestimmt, haftet der Verkäufer für alle Abweichungen von dem durch den Tierarzt mitgeteilten Ergebnis. Letztlich hat also der Verkäufer auch für Fehler des Tierarztes einzustehen.
Dr. Dietrich Plewa Rechtsanwalt