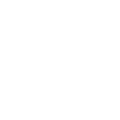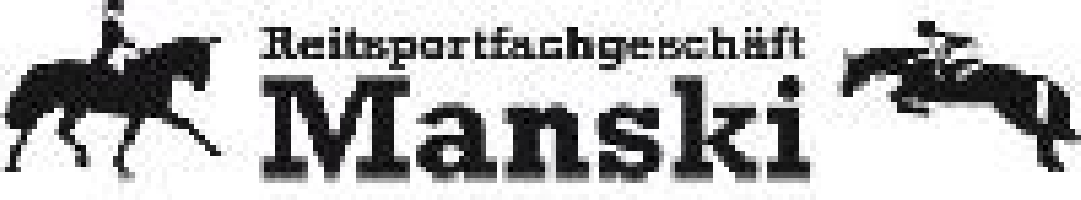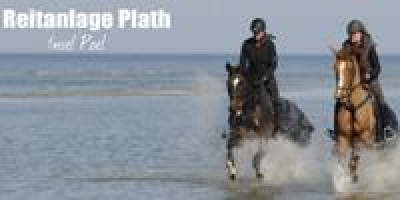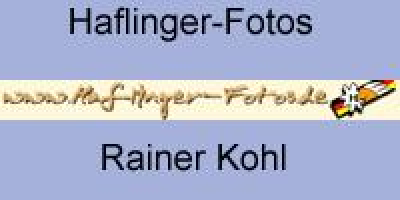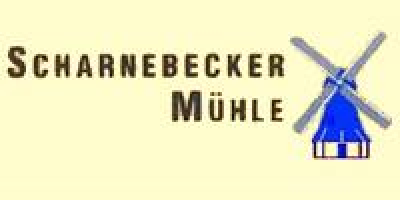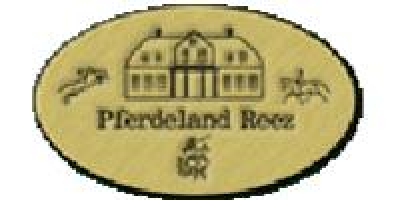Pferde in der Geschichte: Die Schlesischen Kriege
Erschienen am 03.05.2011
Auch in den Schlesischen Kriegen von 1740 bis 1763 spielten sie eine große Rolle
(von Walther Rohdich 1. Teil)
Einleitung
Soweit unsere Kenntnisse historischer Kriege reichen, hat der Mensch Pferde in seine Kriege einbezogen: Auf uralte Daten und Fakten können hier nicht näher eingehen, aber eines sollten wir immer wieder tun: den Pferden unserer Geschichte Denkmäler setzen. Und zwar nicht nur denen, die in den Brennpunkten des Geschehens mitmachen mußten, nämlich in den Gefechten, Schlachten und Entscheidungen, sondern auch jenen im Hintergrund, die heranschafften, herbeikarrten und zuschleppten bis sie in den Deichseln, vor schweren Kanonen und überladenen Transportwagen zusammenbrachen und achtlos liegen gelassen wurden.
Unbeachtet-Sein ist überhaupt ihr Schicksal, denn schreibende und zeichnende Berichterstatter der Zeit wandten sich eher dekorativen Geschehnissen zu. Berichten wir von diesen Vierbeinern, so lernen wir Qualen und Elend in Dimensionen kennen, die selbst in unserer heutigen Gesellschaft, die allerhand Schandtaten gewohnt ist, unglaubwürdig klingen mögen.

Das Thema
Unser Berichtszeitraum hat Leben, Wirken und Leiden der Militärpferde in den drei Schlesischen Kriegen zum Thema, die mit zwei friedlichen Zwischenzeiten von 1740 bis 1763 stattfanden. Es ging damals um den Besitz jener blühenden Provinz Schlesien, die Preußen den Österreichern streitig machte, heute jedoch zum größten Teil polnisch ist.
Als König Friedrich II von Preußen 1740 mit dem Einmarsch in Schlesien den ersten Krieg auslöste, ahnte er nichts von der Lawine des Schreckens und Grauens, die er damit in Gang setzte: Nur selten in der Geschichte hat sich ein Eroberer derartig geirrt. Die Kontrahenten der beiden ersten Kriege sind Preußen, Sachsen und Österreich, später im dritten gesellen sich allerlei Beutegierige wie Frankreich, Rußland, England, Schweden und das ?Reich? hinzu.
Sie alle werfen ihre Streitkräfte ins Feld, so groß und stark wie sie können, unter diesen befinden sich viele Reiter, Pferde, gemeinsam Kavallerie geheißen, und der umfangreiche Fuhrpark, den eine Armee zu unterhalten pflegte und der ohne Zugpferde nicht arbeiten kann.
Der Dreißigjährige Krieg des 17. Jahrhunderts war knapp 100 Jahre vorüber und der Bevölkerung noch in übler Erinnerung. In ihm hatten die Kavallerie und die Versorgung der Armee durch von Pferden beförderten Nachschub bereits eine große Rolle gespielt, aber es war damals noch Angewohnheit gewesen, sich aus dem Land, in dem man stand, zu versorgen - das heißt zu rauben und zu plündern, was man bekommen konnte. Ein Dorf, ein Bauerngehöft, ein Weiler, waren immer in der Nähe und mußten Menschen und Pferde ernähren.
In dieser Beziehung gedachte man im 18. Jahrhundert durchaus humaner und anständiger zu sein, denn mit verwüsteten und bis zum Letzten ausgeraubten Landstrichen konnte man nichts anfangen. Besser war es, man ließ die Landwirtschaft so ungeschoren wie möglich, um sie auch in Zukunft hernehmen zu können.
Die vielen Pferde
Aus ihr, der Landwirtschaft, vom kleinen Kötter bis zur staatlichen Domäne, stammten nämlich alle Pferde und ihr Futter. Alles wurde regelmäßig bezahlt, besonders in Preußen. Erinnern wir uns, daß Friedrichs Vater, Friedrich Wilhelm, Trakehnen anlegen ließ, auch um Pferde für die Armee zu bekommen, die nicht durch viele Ackerarbeit für die Soldaten ?verdorben? waren. Als Friedrich 1740 die von seinem Vater angesparte Armee übernahm, war diese, dem Trend der Zeit folgend, eine Armee von Fußgängern.
Die Verantwortlichen in Preußen maßen der Kavallerie nur untergeordnete Bedeutung bei, wie die meisten anderen Staaten auch. Nur in Österreich war es der Tradition wegen anders: Hatten sich die Österreicher doch viele hundert Jahre mit fremden Reitervölkern bekriegen müssen. Auch die Russen brachten 1758 viel Reiterei zusammen, damals Kasaken genannt, auf kleinen flinken Pferdchen wurden sie der Schrecken der Bevölkerung an Oder und Neiße.
Herzstück jeder Armee war die Infanterie, aber im Verlauf der vielen Schlachten ging allen Feldherren manches Licht auf, was alles man mit schnellen Reitern anstellen konnte. Und auch derjenige General der Infanterie, der die Kavallerie als Nebenwaffe betrachtete, benötigte doch eine Menge Pferde zum Überleben seiner Soldaten und für eine reibungslose Funktion der gesamten Armee.
Voran, bevor wir uns den Pferden als Opfer der Kämpfe zuwenden, ein paar Zahlen zum Staunen: Als die Österreicher den verbündeten Russen im dritten und vierten Jahr des Siebenjährigen Krieges 1758 und 1759 die Übernahme ihrer Verpflegung zusagten, nahmen sie ?den Mund reichlich voll?, wohl weil die Intendantur schlecht rechnete. Denn sie benötigten 2 400 Proviantwagen mit je vier Zugpferden davor, was allein 9 600 Pferde ausmachte. Rechnen wir Ersatzpferde und diejenigen der Bedeckung und Bewachung hinzu, dann bewegte sich ein Troß von etwa 10 000 Pferden durch die Landschaft. Allein die Kolonne der 2 400 Wagen zog sich in eine Länge von mindestens sechs Kilometern dahin. Über die Folgen solch gigantischer Unternehmungen werden wir später mehr berichten.
Reiter und Pferd
Wie mag damals das Verhältnis Soldat zu Pferd gewesen sein? Greifen wir zurück zum Ersten Weltkrieg, wo man am Anfang noch immer an die Kavallerie glaubte, die Motorisierung aber noch nicht so weit fortgeschritten war, daß man auf Transportpferde ganz verzichten konnte - auch im Zweiten Weltkrieg nicht, wie jeder Teilnehmer des Rußlandfeldzuges erfahren mußte.
Ein Reiter bildet im Idealfall mit seinem Tier eine Einheit, drum liebt und pflegt er es ganz selbstverständlich. Anders verhalten sich Kutscher und Fuhrknechte, die unter Zeitdruck und Zwang arbeiten, meist derbe und wenig zimperliche Kerle. Reiter nutzen die natürlichen Anlagen ihrer Schützlinge aus, nämlich Rennen und Springen, Fuhrknechte arbeiten ihnen entgegen, nämlich durch Ziehen.
Demnach leisten Reitpferde nach guter Ausbildung ihre Arbeit mehr oder weniger freiwillig, Arbeitspferde jedoch nur unter brutalem Zwang. Dieser mag bei friedlichen Tätigkeiten der Landwirtschaft und des überregionalen Transports von Waren annehmbar und nicht zu beanstanden sein, unter den Bedingungen der Kriegshandlungen jedoch gab es für die Zugpferde der Kanonen und Nachschubwagen keine Gnade. Es leben noch Mitbürger unter uns, die die Verhältnisse des letzten Krieges in Erinnerung haben, wir können davon ausgehen, daß sie in früheren Kriegen nicht besser waren.
(wird fortgesetzt)