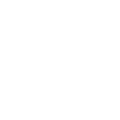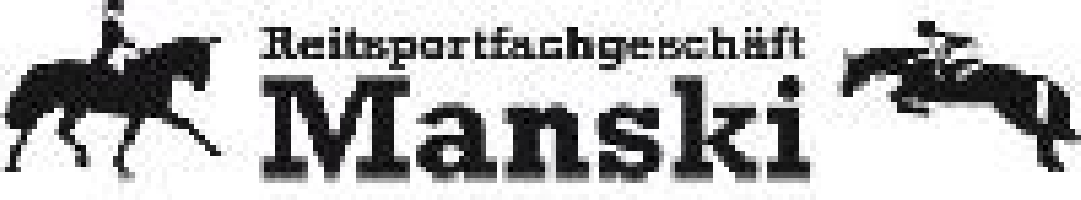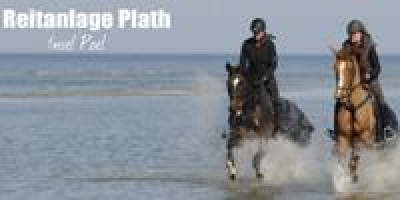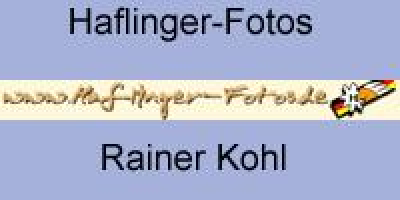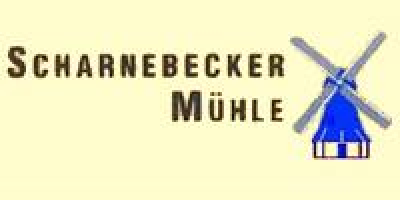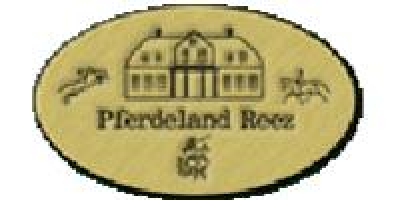Im Blickfeld: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Erschienen am 21.06.2011
Die Vertretung für Mittel- und Ostdeutschland
Wer sind wir und welche Aufgaben haben wir?
Die gesetzliche Unfallversicherung ist neben der gesetzlichen Krankenversicherung, der gesetzlichen Pflegeversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung eine der fünf Säulen der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland. Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung mit ihren Trägern, den Berufsgenossenschaften, ist es, mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten und nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen zu entschädigen. Im Sinne einer zielgenauen Prävention sind die Berufsgenossenschaften sachlich gegliedert. Den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sind die in § 123 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 Sozialgesetzbuch VII -SGB VII- aufgeführten Unternehmen zugewiesen. Das sind die
1. Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft einschließlich des Garten- und Weinbaues,
der Fischzucht, Teichwirtschaft, Seen-, Bach- und Flussfischerei (Binnenfischerei), der
Imkerei sowie der den Zielen des Natur- und Umweltschutzes dienenden Landschafts-
pflege,
der Fischzucht, Teichwirtschaft, Seen-, Bach- und Flussfischerei (Binnenfischerei), der
Imkerei sowie der den Zielen des Natur- und Umweltschutzes dienenden Landschafts-
pflege,
2. Unternehmen, in denen ohne Bodenbewirtschaftung Nutz- oder Zuchttiere zum Zwecke
der Aufzucht, der Mast oder der Gewinnung tierischer Produkte gehalten werden,
der Aufzucht, der Mast oder der Gewinnung tierischer Produkte gehalten werden,
3. land- und forstwirtschaftlichen Lohnunternehmen,
4. Park- und Gartenpflege sowie Friedhöfe,
5. Jagden,
6. Landwirtschaftskammern und die Berufsverbände der Landwirtschaft,
7. Unternehmen, die unmittelbar der Sicherung, Überwachung oder Förderung der Land-
wirtschaft überwiegend dienen,
wirtschaft überwiegend dienen,
8. Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, deren Verbände und deren weitere
Einrichtungen sowie die Zusatzversorgungskasse und das Zusatzversorgungswerk für
Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft.
Einrichtungen sowie die Zusatzversorgungskasse und das Zusatzversorgungswerk für
Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft.
Darüber hinaus sind die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften auch für andere, neben der Landwirtschaft betriebene Unternehmensteile zuständig, wenn die Landwirtschaft dem gesamten Unternehmen das Gepräge gibt (§ 131 SGB VII).
Wer ist gegen den Eintritt eines Arbeitsunfalls versichert?
Für die landwirtschaftliche Unfallversicherung hat der Gesetzgeber den Kreis der versicherten Personen besonders weit gefasst (§ 2 Abs. 1 Nr.1 und 5 SGB VII). Danach sind versichert
- Beschäftigte (Arbeitnehmer),
- die landwirtschaftlichen Unternehmer und ihre im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten
oder Lebenspartner,
- im landwirtschaftlichen Unternehmen nicht nur vorübergehend mitarbeitende Familienange-
hörige,
- in landwirtschaftlichen Unternehmen in der Rechtsform von Kapital- oder
Personenhandelsgesellschaften regelmäßig wie Unternehmer selbständig Tätige,
- ehrenamtlich Tätige (Vorstandsmitglieder) in Unternehmen, die unmittelbar der Sicherung,
Überwachung oder Förderung der Landwirtschaft überwiegend dienen
- in landwirtschaftlichen Berufsverbänden ehrenamtlich Tätige.
Wann liegt ein Unternehmen vor und wer ist Unternehmer?
Ein landwirtschaftliches Unternehmen liegt bereits vor, wenn landwirtschaftliche Arbeiten verrichtet werden. Auf die Motivation des Tätigwerdens kommt es nicht an. Es ist also völlig unerheblich, ob ein gewerbliches Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird oder die landwirtschaftlichen Arbeiten im Rahmen der Freizeitgestaltung oder aus Hobbygründen erfolgen. Derjenige, in dessen Verantwortung und auf dessen Rechnung (z.B. Kosten) die landwirtschaftlichen Arbeiten durchgeführt werden, ist der landwirtschaftliche Unternehmer. Die Eigentumsverhältnisse an Flächen und Tieren, das gilt besonders für Pferde, spielen mit Blick auf den Unternehmerstatus keine Rolle.
Wichtig: Die Zugehörigkeit des Unternehmens zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft tritt kraft Gesetzes ein, das heißt die Beteiligten (Unternehmer und Berufsgenossenschaft) können sich weder für noch gegen die gesetzliche Unfallversicherung entscheiden. Eine ggf. privat abgeschlossene Unfallversicherung ist stets nachrangig und kann bestenfalls eine zusätzliche Absicherung sein.
Welche Leistungen werden bei einem Unfallereignis erbracht?
Die landwirtschaftliche Unfallversicherung bietet einen umfassenden Versicherungsschutz bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles erbringt die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft die Leistungen der Heilbehandlung. Sie hat mithin alle Kosten zu tragen, die im Rahmen der Wiederherstellung der Gesundheit des Verletzten entstehen. Das sind auch Kosten, die ggf. zunächst bei den gesetzlichen Krankenkassen auflaufen und von der Berufsgenossenschaft zu erstatten sind.
Zu den Leistungen, die die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft darüber hinaus erbringt, gehören im Wesentlichen
- die Gewährung von Betriebs- oder Haushaltshilfe,
- die Zahlung von Verletztengeld,
- die Zahlung von Unfallrenten an Versicherte (Verletztenrente),
- die Erbringung von Leistungen bei Pflegebedürftigkeit,
- die Erbringung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
- die Erbringung von Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft,
- die Erbringung von Leistungen bei Tod.
Wie wird die landwirtschaftliche Unfallversicherung finanziert?
Die Mittel für die Ausgaben der Berufsgenossenschaft werden ausschließlich durch die der Berufsgenossenschaft zugehörigen Unternehmer in Form von Beiträgen aufgebracht. Dabei werden die Beiträge auf der Grundlage der Ausgaben des abgelaufenen Geschäftsjahres festgesetzt und erhoben (Prinzip der nachträglichen Bedarfsdeckung). Die Höhe des Beitrages wird im Wesentlichen bestimmt durch
- die Gesamtausgaben der Berufsgenossenschaft (auch Umlage bezeichnet)
- den Beitragsmaßstab
- die Art und den Umfang der im Unternehmen durchgeführten Produktionsverfahren
(Flächengröße und die jeweilige Anbaukultur)
- die Art und die Anzahl der gehaltenen Tiere
- die je Produktionsverfahren und Tierart verursachten Kosten der Leistungserbringung und
- die Höhe des Lastenausgleichsbetrages.
Weshalb sind die Beiträge bei den Pferdehaltern im Vergleich zum Vorjahr so massiv angestiegen?
Die Selbstverwaltung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Mittel- und Ostdeutschland hatte bis einschließlich für das Geschäftsjahr 2009 die Beitragsberechnung für Unternehmen der Bodenbewirtschaftung mit oder ohne Tierhaltung auf der Grundlage eines Flächenwertes zuzüglich eines einheitlichen Grundbeitrages und für Nebenunternehmen der Pferdehaltung auf der Grundlage eines Arbeitsbedarfswertes verbindlich festgelegt. Die Unfallgefahr war kein bestimmender Faktor für den Beitragsmaßstab und lediglich ausreichend zu berücksichtigen.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG) vom 18.12.2007 war den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften aufgegeben, spätestens ab dem 01.01.2010 die Beitragsmaßstäbe weiterzuentwickeln und die Beiträge am Unfallrisiko zu orientieren, ohne den Solidargedanken zu vernachlässigen.
In Umsetzung des LSVMG hat die LBG MOD als letzte der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften einen neuen Beitragsmaßstab, den Arbeitsbedarfsmaßstab, eingeführt und der Beitragsberechnung zugrunde gelegt. Danach erfolgt die Berechnung des Beitrages für Unternehmen der Bodenbewirtschaftung mit oder ohne Tierhaltung aber auch für die Nebenunternehmen der Pferdehaltung ab dem Umlagejahr 2010 auf der Grundlage des Arbeitsbedarfes zuzüglich eines einheitlichen Grundbeitrages. Der Arbeitsbedarfsmaßstab ist ein Abschätztarif, d. h. er berücksichtigt nicht den im jeweiligen Unternehmen tatsächlich anfallenden Arbeitsbedarf. Er fußt vielmehr auf gutachterlich festgesetzten Durchschnittswerten unter Berücksichtigung der strukturellen Besonderheiten im Zuständigkeitsbereich der LBG Mittel- und Ostdeutschland und wird in Berechnungseinheiten (BER), differenziert nach speziellen Produktionsarten und -formen, den sogenannten Produktionsverfahren abgebildet.
Im Unterschied zur bisherigen Beitragsberechnung erfolgt somit eine stärkere Differenzierung nach Kultur- und Tierarten. Die BER werden mit der Größe der bewirtschafteten Fläche je Produktionsverfahren in Hektar und der Anzahl der durchschnittlich jährlich gehaltenen Tiere und einem anhand des Beitragsdeckungsverhältnisses festgesetzten Unfallfaktor vervielfältigt. Das Beitragsdeckungsverhältnis ist das Verhältnis des Beitragsaufkommens in den jeweiligen Produktionsverfahren und bei den Unternehmensarten zu den verursachten Leistungskosten. Der Unfallfaktor bestimmt somit maßgeblich die Höhe des Beitrages.
Neben der Forderung der Weiterentwicklung der Beitragsberechnungsgrundlagen (§ 221 b SGB VII) sind nach den Bestimmungen des LSVMG zum 01. Januar 2010 Regelungen zu einem Lastenausgleich der Rentenlasten (Altrenten) zwischen den einzelnen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften getroffen worden (§§ 184 a ff SGB VII). Ziel des Lastenausgleichsverfahrens ist, die innerlandwirtschaftliche Solidarität bundesweit zu stärken. Das heißt, dass landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften, bei denen aufgrund der strukturellen Gegebenheiten die Belastungssituation günstiger als der Durchschnitt aller landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ist, hierzu zählt die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Mittel- und Ostdeutschland, ausgleichspflichtig sind. Dies bedeutet konkret, dass die beitragspflichtigen Unternehmer der LBG Mittel- und Ostdeutschland in Form des Lastenausgleichs zusätzlich belastet werden. Die zusätzliche Belastung schlägt sich in der Erhöhung des Bruttohebesatzes um 28,34 % nieder. Damit entfallen allein rd. 30% der Beitragsforderungen auf den zusätzlich zu finanzierenden bundesweiten innerlandwirtschaftlichen Solidarpakt.