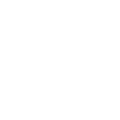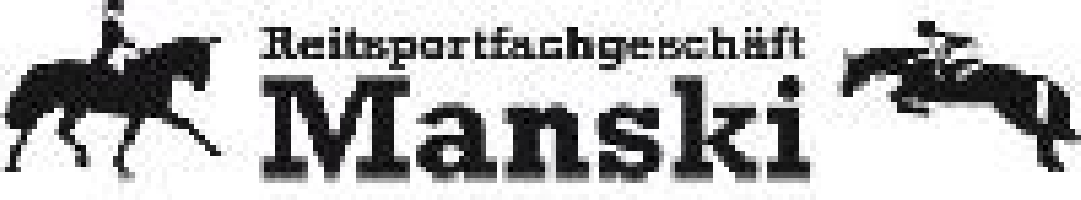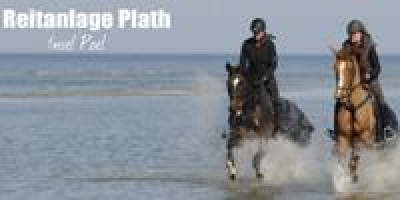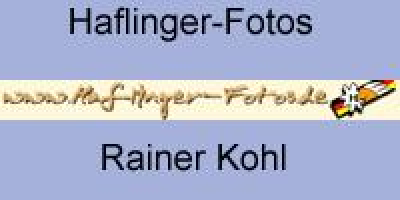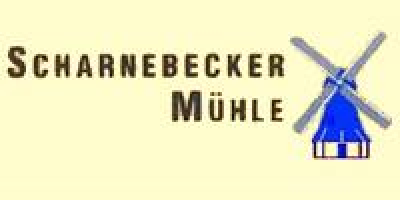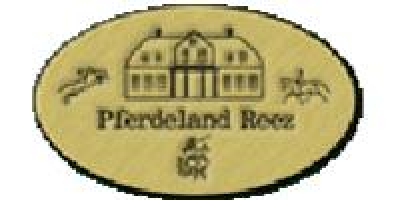Der Zuchtwert muss weg
Erschienen am 01.02.2012
Nach der HLP-Reform - eine Zwischenbilanz von Claus Schridde
Die Hengstleistungsprüfungen 2011 sind gelaufen. Alles sollte neu werden, alles sollte besser werden, am Ende gab es bei Hengstbesitzern, Prüfungsanstalten und Zuchtfunktionären mehr Frust denn je und es blieben viele Fragen offen. Zu den technischen Abläufen, die doch erhebliche Kinderkrankheiten aufwiesen, sind inzwischen erste Änderungen beschlossen worden, die 2012 Anwendung finden sollen. Eine Reform des alten Hengstleistungsprüfungs-Systems war längst überfällig. Nicht nur die Änderung des Tierzuchtgesetzes sondern die verlorengegangene Akzeptanz der Züchter machte sie notwendig.

Mecklenburger Ce-Matin v. Cellestial / Carpaccio mit Paul Wiktor beim 70-Tage-Test 2011 (Wertnote 8,1). Foto: Wego
Das Indexsystem funktionierte so, dass, am Beispiel einer Schulklasse erklärt, sechs Schüler eine Sechs schreiben mussten, damit sechs andere eine Eins bekamen. In der Praxis war es oft so, dass Hengste mit 7er Noten ohne Totalausfall trotzdem nur wenig Punkte bekamen, wenn das Gesamtniveau der Prüfung hoch war.
Jetzt ist es so, dass nicht die vom Hengst erzielte Note, also seine eigene Leistung zählt, sondern ein imaginärer Zuchtwert, der sich aus den HLP-Ergebnissen der Vorfahren errechnet. Ein Hengst kann in der eigenen Bewertung (absolute Note!) so gut sein wie er will, er erhält dennoch nur mäßige Zuchtwerte, weil seine Vorfahren eben nur mäßige Zuchtwerte hatten. Auch da liefert das deutsche Schulsystem ein schönes Vergleichsbeispiel: Auf die Schule übertragen bedeutet der HLP-Zuchtwert nämlich in etwa, dass ein Schüler nur deshalb kein Abitur ablegen kann, weil sein Vater und Großvater von der Schule abgehen mussten und es insofern auch nicht konnten. Das unschöne Wort der Sippenhaft kommt einem unweigerlich in den Sinn, und die sollte in Deutschland doch eigentlich abgeschafft sein.
Mittelmäßiger Wert trotz bester Leistungen?
Als praktisches Beispiel mag der Trakehner Reservesiegerhengst 2010, Herbstkönig (v. Interconti-Timber-Caanitz), im gemeinschaftlichen Besitz des baden-württembergischen Haupt- und Landgestüts Marbach und des in Niedersachsen gelegenen Klosterhofes Medingen dienen. Er hatte im Sommer die hohe Einschätzung der Körung als Trakehner Champion in Hannover eindrucksvoll untermauert, brachte jedoch im 70 Tage-Test im Springen gerade mal 80 Punkte (mit der durchaus ordentlichen Endnote 7,61) und in der Dressur 112 (Endnote 8,58). Die sehr hohe Dressur-Endnote hilft ihm jedoch nicht viel, weil seine Vorfahren niedrigere Noten hatten und der HLP-Zuchtwert somit gerade einmal 112 ausmacht. In Anbetracht der hohen Anschaffungskosten (180.000 Euro) wird die Amortisierung sicher nun auf sich warten lassen, denn nur über Trakehner und Württemberger Stuten wird das in heutiger Zeit mittelfristig kaum zu schaffen sein. Im Wohngebiet des Mitbesitzers Burkhard Wahler (Zuchtgebiet Hannover) wird Herbstkönig nämlich trotz aller unbestreitbaren Qualität mit einem Mittelwert von 96 Punkten nicht einmal zur Anerkennung vorgestellt werden können.

Holsteiner Caress v. Casall / Heraldik xx beim 70-Tage-Test in Redefin 2011 (Gesamtnote 7,38). Fotos: Wego
Während die meisten deutschen Pferdezuchtverbände die von der FN vorgegebene Minimalgrenze von 80 Punkten übernommen haben, hat der Hannoveraner Verband noch vor Ablauf der ersten Tests nach dem neuen Bewertungssystem, folglich ohne jeden Erfahrungswert, für fremde und eigene Hengste jeweils stolze Minimalgrenzen festgelegt. Die für die hannoversche Zuchtbuchanerkennung geforderten Durchschnittswerte betragen demnach für hannoversch gebrannte Hengste 100 Punkte und 110 für in anderen Gebieten gezogene Hengste.
Festzuhalten ist: Wenn ein Pferd trotz guter Leistung keinen positiven Zuchtwert erzielen kann, dann hat sich das neue System schon jetzt ad absurdum geführt. Im Gegenzug kann ein Hengst mit schwacher Eigenleistung aufgrund hoher Vorfahrenleistung doch in den Genuss der Deckerlaubnis kommen und so großen Flurschaden anrichten.
Das Jahr 2011 hat gezeigt: Nachkommen der Hengste Stakkato im Springen oder Sir Donnerhall I in der Dressur brauchen sich selbst gar nicht mehr sonderlich anzustrengen, hohe Punkte sind ihnen schon aufgrund ihrer Herkunft von vorn herein gewiss. Im Gegenzug dazu sind Vollblüter, Trakehner und Hengste ausländischer Herkunft qualitätsunabhängig regelrechte Zuchtwertvernichter.
Die absolute Note - sowohl positiv als auch negativ - ist deutlich aussagekräftiger als ein schwer erklärbares Phantasiegebilde wie etwa früher der Index oder nunmehr ein Zuchtwert. Insofern sollte eine Mindestnote zur Anerkennung zugrunde gelegt werden, und nicht etwa ein Mindestzuchtwert, der im Grunde gegenwärtig nicht mehr ist als ein höchst unsicheres Zahlenspiel bedeutet. Das neue System wurde schlichtweg nicht zu Ende gedacht und kann fatale Folgen haben: Der ohnehin beängstigend kleine Anteil an Vollblutbedeckungen wird noch weiter zurückgehen und die genetische Basis wird sich zunehmend auf wenige, vorher berechenbare Hengste verengen. Doppelveranlagung gibt es im heutigen System so gut wie gar nicht mehr; Vielseitigkeitspferde fallen völlig unter den Tisch.
Süddeutscher Weg macht Sinn
Ein Zuchtwert als ergänzende Information, dagegen hätte sicherlich niemand etwas. Die inzwischen veröffentlichte süddeutsche HLP-Bestehensregel macht halbwegs Sinn und lässt den Pferden die Chance, auch mit mittelmäßigen Zuchtwerten zumindest in der Zucht zu verbleiben und sich als Vererber zu beweisen. Demnach muss die Endnote 7,0 oder eine Disziplin-Endnote 8,0 betragen und 100 Punkte in einem Zuchtwert erzielt werden. Bei Hengsten, die einen Blutanteil von 50 Prozent in den ersten beiden Generationen aufweisen, gelten die gleichen Notengrenzen, jedoch der Mindestzuchtwert von 80.
In der deutschen Pferdezucht wird seit einiger Zeit immer häufiger das Aufholen (Überholen???) durch die Niederländer und Dänen beklagt. Den HLP-Zuchtwert daher als neues Selektionsinstrument anzusehen, ist letztlich lächerlich: Selektion muss auf den Körungen und Stutbucheintragungen erfolgen. Vielleicht sollte weniger für den Markt gekört und bei der Stutbucheintragung nicht jede Stute mit Mängeln doch noch ins Hauptstutbuch gehievt werden, dann wäre schon viel gewonnen. Die oft postulierte Einstellung, der Markt wird es schon regeln, ist falsch: Denn der Markt regelt es eben nicht!
Es ist anzunehmen, dass das Vertrauen der Züchter in die derzeitige Form der Hengstleistungsprüfungen künftig weiter abnehmen wird. Es ist nicht mehr als eine Milchmädchenrechnung, die Geld verschlingt und Leute beschäftigt, am Ende aber so überflüssig ist wie ein Kropf. Es ist an der Zeit, dass die Verantwortlichen der deutschen Pferdezucht inklusive der Pferdewissenschaftler sich wieder mehr auf die Praxis besinnen. Wissenschaftlich (stark hinkende!!!) Vergleiche mit der Rinderzucht, wie etwa im vergangenen Jahr mehrfach bei den "Göttinger Pferdetagen" praktiziert, hat es früher nicht gegeben. Und das war auch gut so. (Claus Schridde)