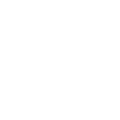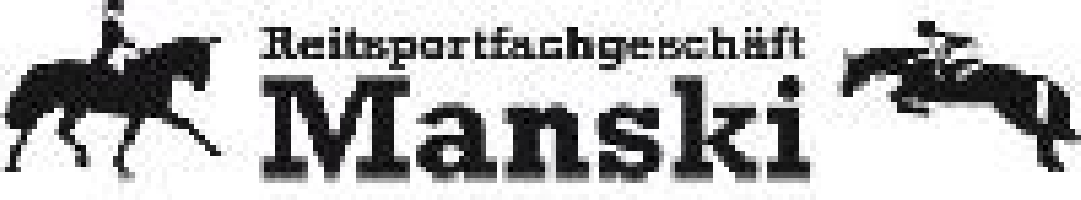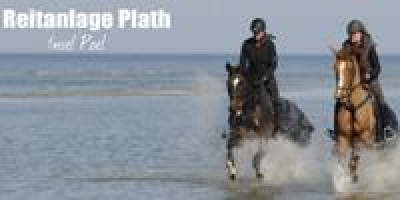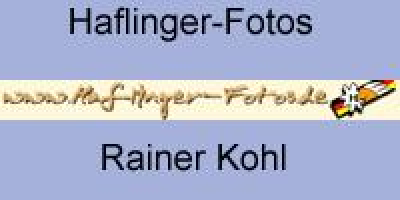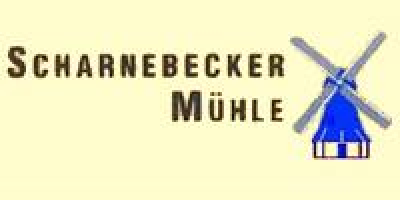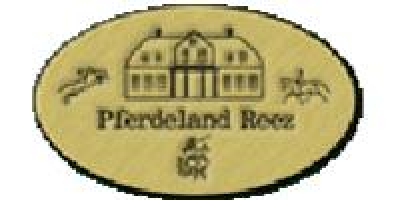Junghengstkörung auf dem Prüfstand
Erschienen am 15.03.2012
Forum junger Züchter in Eyendorf

Zuchtexperte Claus Schridde leitete die Veranstaltung in Eyendorf. Er ist ein bekennender Gegner der Zuchtwertschätzung. Foto: Wego
Mit dem Thema "Junghengstkörung unter dem Sattel, der richtige Weg in die Zukunft?" hatte das "Forum junger Züchter" des Bezirksverbandes Lüneburg am 2. Februar nach Eyendorf in die Lüneburger Heide eingeladen. Während der von Claus Schridde (Querenhorst) moderierten Abendveranstaltung kamen Oldenburgs Zuchtleiter Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff (Vechta), Hannovers Zuchtleiter Dr. Werner Schade (Verden) und der Züchter, Hengsthalter, Auktionsleiter und langjährige Leiter einer Hengstprüfungsanstalt, Burkhard Wahler (Bad Bevensen-Medingen), zu Wort.
Zunächst gab Claus Schridde eine Einführung in das Thema: "Die Körung dient seit Mitte des 19. Jahrhunderts der Selektion von Vatertieren zur Verbesserung der Pferdezucht. In diesen nunmehr weit über 150 Jahren ist viel passiert, das Pferd ist nicht mehr nur Wirtschafts- oder Kavalleriepferd, sondern Reitpferd. Entsprechend sind die Selektionskriterien immer wieder verändert und angepasst worden.
In den letzten 25 Jahren hat die künstliche Besamung großflächig in der weltweiten Pferdezucht Einzug gehalten, das regionale Denken ist unendlichen globalen Möglichkeiten gewichen. Gestern noch populäre Hengstlinien sind deshalb trotz aller Wertschätzung heute nicht mehr vorhanden oder im Bestand stark gefährdet, weil zu viele Züchter jeweils die gleichen Hengste als begehrlich empfinden. Damit wird schon deutlich, dass es heutzutage insgesamt einen deutlich geringeren Bedarf an Vatertieren gibt. Gekört wird in allen Verbänden dennoch immer eine große Anzahl an Hengsten, deutlich mehr, als die Population im Grunde benötigt. Lange Zeit war immer die Rede davon, das wird der Markt schon regeln, aber der Markt regelt es eben nicht. Vielleicht ist es daher wieder einmal an der Zeit, über eine Veränderung des Körsystems nachzudenken."
Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff erklärte: "Mit deutscher Genetik ist Nachbarländern wie Belgien, Dänemark und den Niederlanden ein großer Zuchtfortschritt gelungen. Und wenn diese Nationen uns auf den Fersen sind oder versuchen, uns zu überholen, dann müssen wir uns Gedanken machen. Aus der zentralen Stutenleistungsprüfung, die in Oldenburg die Vorstufe zur Stutenprämierung bzw. Zulassung zur Elite-Stutenschau darstellt, haben wir viele positive Erfahrungen gewonnen. Den dreijährigen Stuten wird eine Stutenleistungsprüfung zugemutet, also ist auch dreijährigen Hengsten ein Ein-Tages-Test zuzumuten. Ziel ist es, keinen Hengst ungeprüft in den Deckeinsatz zu lassen.
Gegenwärtig ist es so, dass Junghengste, und hier speziell die dressurbetonten, auf Hengstvorführungen stark protegiert werden. Dass ein Dreijähriger bis zu 600 Stuten deckt, ist nicht gewünscht. Fände die Körung erst im Frühjahr statt, anschließend ein 30-Tage-Test, würde der Deckeinsatz im Mai starten und dadurch allein biologisch begrenzt stattfinden. Natürlich ergeht der Appell an alle Zuchtverbände, denn wenn nur Oldenburg diesen Weg geht, werden unsere Hengstaufzüchter Ausweichbewegungen machen, das ist mir zwar einerseits klar, kann aber nicht der Sinn sein. Im Hinblick auf den Umsatz des Verbandes muss man den Baum wohl auf beiden Schultern tragen, aber der Hengstmarkt im Herbst kann für die Selektion nicht optimal sein. Die Einführung des 30-Tage-Tests vor zwölf Jahren ist gescheitert. Die Hengsthalter haben ihre Hengste trotzdem decken lassen, sie in den Test geschickt und während deren Abwesenheit zu Hause mit TG-Sperma munter weiter besamt. Das war nicht Sinn und Zweck der Übung, den 30Tage-Test dem Deckeinsatz vorzuschalten."

Hannovers Zuchtleiter Dr. Werner Schade mein, dass das bewährte System der Körung nicht mehr richtig gelebt wird. Foto: Wego
Dr. Werner Schade führte danach aus: "Viele dieser guten Gedanken decken sich mit unserer Philosophie. Das bewährte System wird nicht mehr richtig gelebt. Es werden zu viele Kompromisse gemacht. Bei 16 Zuchtverbänden wird immer nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht. Die Bewegung an der Hand ist sehr wichtig, hat einen hohen Informationsgehalt, ist aber letztlich nur ein Mosaikstein. Grundsätzlich sind wir aus hannoverscher Sicht nicht unzufrieden mit der Trefferquote auf unseren Körungen. Jeder kann sich mal irren, und ab und zu schaut man auch mal an einem Hengst vorbei. Die vorläufige Anerkennung vor der HLP ist ein fauler Kompromiss.
Meine Meinung ist: Körung zweieinhalbjährig, dreijährig kein Deckeinsatz. Zum Körzeitpunkt im Herbst sind Exterieur und Freilaufen gut zu bewerten. Die Körkommissionen stehen oft unter Druck, man muss aber diesem Druck standhalten und macht sich dadurch nicht nur Freunde. Wenn im März gekört würde, wäre das nicht eine Entwicklung zur Reiterkörung? Nehmen wir zum Beispiel das Bundeschampionat. Dieses ist auch nur beschränkt auf einen bestimmten Kreis von Reitern. Und es gibt die Gefahr, dass die Hengste dann noch früher geritten werden."
Burkhard Wahler: "Der hier von Hannover oder Oldenburg angeregte Weg zu Veränderungen ist letztlich egal. Er muss nur konsequent gegangen werden. Letztlich führen viele Wege nach Rom, und die Körselektion muss wesentlich intensiviert werden. Was wir brauchen, ist vor allem ein korrektes Fundament!" Wahler weiter zum Zeitpunkt des Anreitens junger Hengste: "Wenn ein zweieinhalbjähriger Hengst im Herbst in Maßen angeritten wird, ist das nicht schlimm!"
Claus Schridde gab zu bedenken: "Körungen unter dem Reiter finden in Hannover und Oldenburg schon lange Jahre statt, in aller Regel mit wenig Öffentlichkeit. Dabei ist jeder Hengsthalter bemüht, seinen Hengst möglichst optimal beritten vorzustellen. Von Reiterkörung kann hier insofern eigentlich nicht wirklich die Rede sein."
Da Körung und Hengstleistungsprüfung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, ging die Debatte nach Austausch der Standpunkte zum Körsystem in dieser Thematik weiter. Burkhard Wahler weiß, wovon er spricht: "Das war keine Reform, sondern höchstens ein Reförmchen! Es ist schwer, heute gutes Personal zu finden. Die Hengste sind unser Kapital, die müssen wir irgendwohin schicken und dort ihrem Schicksal überlassen! Und was die Bewertung angeht, müssen wir uns auf das verständigen können, was wir sehen. Wir können Dinge nicht so lange hin und her rechnen, bis es gar keiner mehr versteht." Schade: "Wir haben kein besseres Verfahren gefunden. Dieses Prüfungsmodell ist nicht für Hengsthalter gemacht!" Und wieder Schulze-Schleppinghoff: "Die Zuchtwertschätzung kann grundsätzlich sicherlich ein wertvolles Mittel sein, diese HLP-Zuchtwertschätzung hat aber fachliche Mängel und ist als alleiniges Selektionsmerkmal höchst fragwürdig." Zusammengefasst konnte keine Optimallösung in der Körfrage entwickelt werden. Einig sind sich jedoch alle darüber, dass sich etwas verändern muss. (Quelle: ZF)