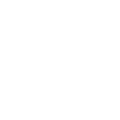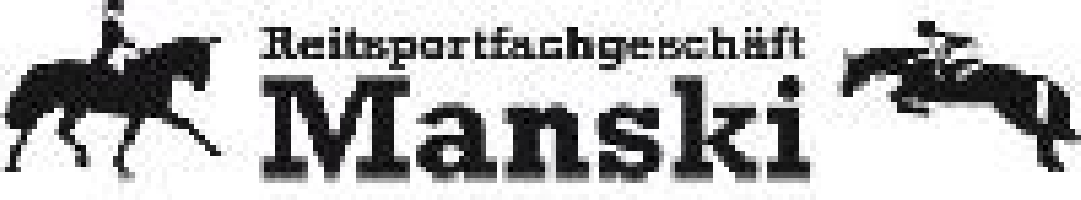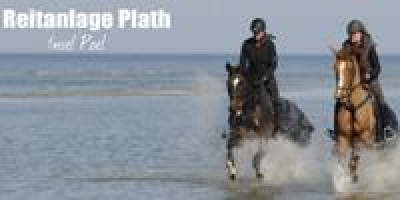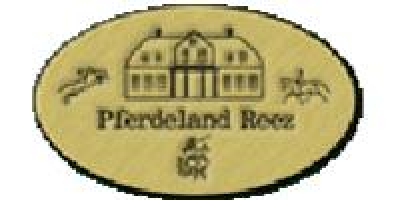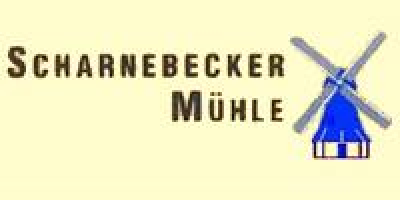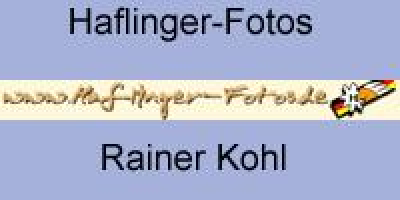Beweisvermutung zugunsten des Verbrauchers bei Kissing-Spines-Syndrom nicht anwendbar?
Erschienen am 06.02.2025

Engstehende oder gar sich berührende Dornfortsätze der Brustwirbelsäule haben die einschlägige Rechtsprechung schon oft beschäftigt. Es handelt sich um einen im Rahmen einer Ankaufsuntersuchung oft festgestellten Befund, der für einen wirksamen Rücktritt vom Vertrag aber kaum einmal ausreichen soll.
Ein Beispielsfall
Der Käufer eines Reitpferdes ist wenige Monate nach dem Erwerb vom Vertrag zurückgetreten mit der Begründung, das Pferd sei mangelhaft. Es war im Rahmen der Ankaufsuntersuchung (AKU) klinisch als unbedenklich beurteilt worden, das galt auch für die Rückenmuskulatur. Im Bereich der Sattellage waren allerdings röntgenologisch Kissing-Spines festgestellt worden. Der Verkäufer war Unternehmer. Gegenüber der sich daraus ableitenden Beweisvermutung zugunsten des Käufers hat er sich auf den Standpunkt gestellt, dass das Pferd zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges nicht mangelhaft war. Auch wenn innerhalb von sechs Monaten ab Gefahrübergang gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgetreten waren, die als Kissing-Spines-Syndrom diagnostiziert wurden, wurde der Rücktritt als unwirksam bezeichnet im Hinblick auf das Ergebnis der AKU.
Gefahrübergang und Mangel
Generell haftet der Verkäufer eines Pferdes nur für einen Mangel, der zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges bereits vorlag. Zudem hatte das Pferd gemäß der AKU zum Zeitpunkt der Übergabe engstehende Dornfortsätze. Der Kissing-Spines-Befund hatte aber nach Feststellungen des Tierarztes jedenfalls anlässlich seiner Untersuchung keine klinischen Auswirkungen. Die waren dann noch innerhalb der für die Beweisvermutung zugunsten des Verbrauchers geltenden Frist von sechs Monaten (§ 477 BGB) festgestellt worden. Der im gerichtlichen Verfahren beauftragte Sachverständige führte die geltend gemachten Beschwerden, die auch zu Rittigkeitsproblemen führten, auf den Röntgenbefund zurück. Der Verkäufer war Unternehmer. In erster Instanz hatte das Landgericht der Klage stattgegeben, weil es die Beweisvermutung zulasten des Verkäufers angewendet hat.
Abweichende Meinung
Das Berufungsgericht legte bei seiner Argumentation die Feststellungen des Gerichtssachverständigen zugrunde. Es wies aber darauf hin, dass § 477 BGB lediglich eine Vermutung sei, wonach der innerhalb von sechs Monaten festgestellte Mangel auch zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges bereits vorhanden war. Diese Vermutung ist grundsätzlich widerleglich. Das OLG meinte, dass der dem Unternehmer obliegende Beweis geführt sei, weil das Pferd bei Gefahrübergang und auch in den ersten Monaten danach keine klinischen Symptome gezeigt hatte. Nach seiner Auffassung war der Rücktritt unwirksam, die Klage also unbegründet, weil der dem Unternehmer obliegende Gegenbeweis geführt sei. Zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges sei das streitbefangene Pferd im Rechtssinne nicht mangelhaft gewesen. Das OLG bezog sich auf mehrere Entscheidungen des Bundesgerichtshofes. Der hatte sich bereits mehrfach auch mit dem Röntgenbefund Kissing-Spines befasst. Zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges sei nach den Anforderungen, die der BGH formuliert hat, das Pferd nicht mangelhaft gewesen, weil es noch nicht als krank hat gelten können und auch nicht mit „Sicherheit oder zumindest hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten war, dass es alsbald erkranken werde“. Der gerichtliche Gutachter hatte die Wahrscheinlichkeit für das künftige Auftreten klinischer Befunde mit unter 50 % bewertet.
Der Verbraucherschutz
Die Auffassung des OLG orientiert sich an der Rechtsprechung des BGH, die in mehreren Urteilen zu den rechtlichen Voraussetzungen eines kaufrechtlichen Mangels bezüglich der gesundheitlichen Verfassung eines Reitpferdes ergangen ist. Fraglich allerdings ist, ob sie sich mit der insoweit auch für das nationale Recht verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in Einklang bringen lässt. Danach braucht der Verbraucher lediglich den Beweis zu erbringen, dass der Kaufgegenstand nicht vertragsgemäß ist und dass die Vertragswidrigkeit binnen sechs Monaten nach Gefahrübergang offenbar geworden ist. Die Anwendung des § 477 BGB kann nach Auffassung des EuGH nur dadurch ausgeschlossen werden, dass der Verkäufer hinreichend nachweist, dass der Grund oder Ursprung der Vertragswidrigkeit in einem Umstand liegt, der nach der Lieferung des Gutes eingetreten ist (EuGH, U. 04.06.2015 – Rs C-497/13). Das Urteil des EuGH hat den BGH veranlasst, seine Rechtsprechung zu den Voraussetzungen des § 477 BGB grundlegend zu ändern. In der Grundsatzentscheidung vom 12.10.2016 – VIII ZR 103/15 – heißt es:
- 477 BGB ist richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass dem Käufer die dort geregelte Vermutungswirkung auch dahin zugutekommt, dass der binnen sechs Monaten nach Gefahrübergang zutage getretene mangelhafte Zustand zumindest im Ansatz schon bei Gefahrübergang vorgelegen hat.
Legt man diesen Maßstab zugrunde, dürfte das Vorhandensein des Röntgenbefundes als Anlage und Voraussetzung für die spätere Symptomatik als ausreichend anzusehen sein.
Dr. Dietrich Plewa
Rechtsanwalt / Fachanwalt